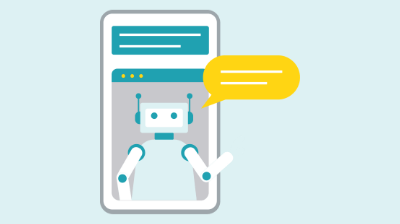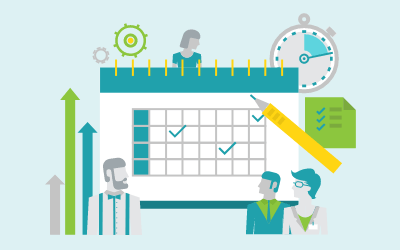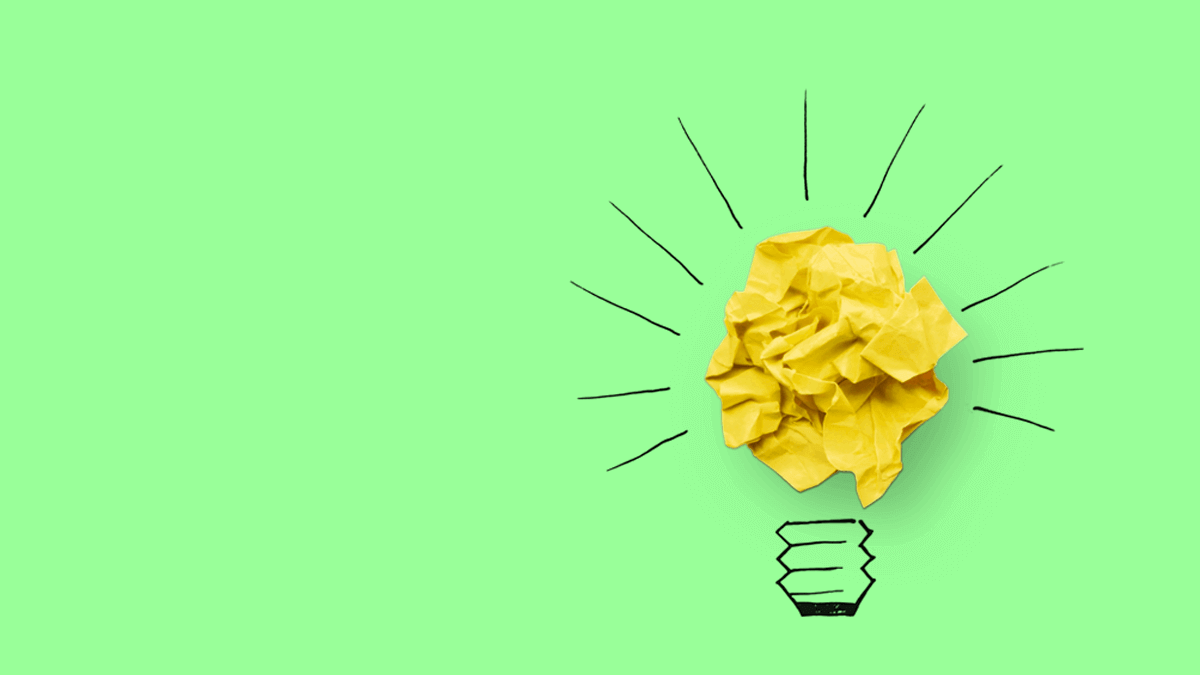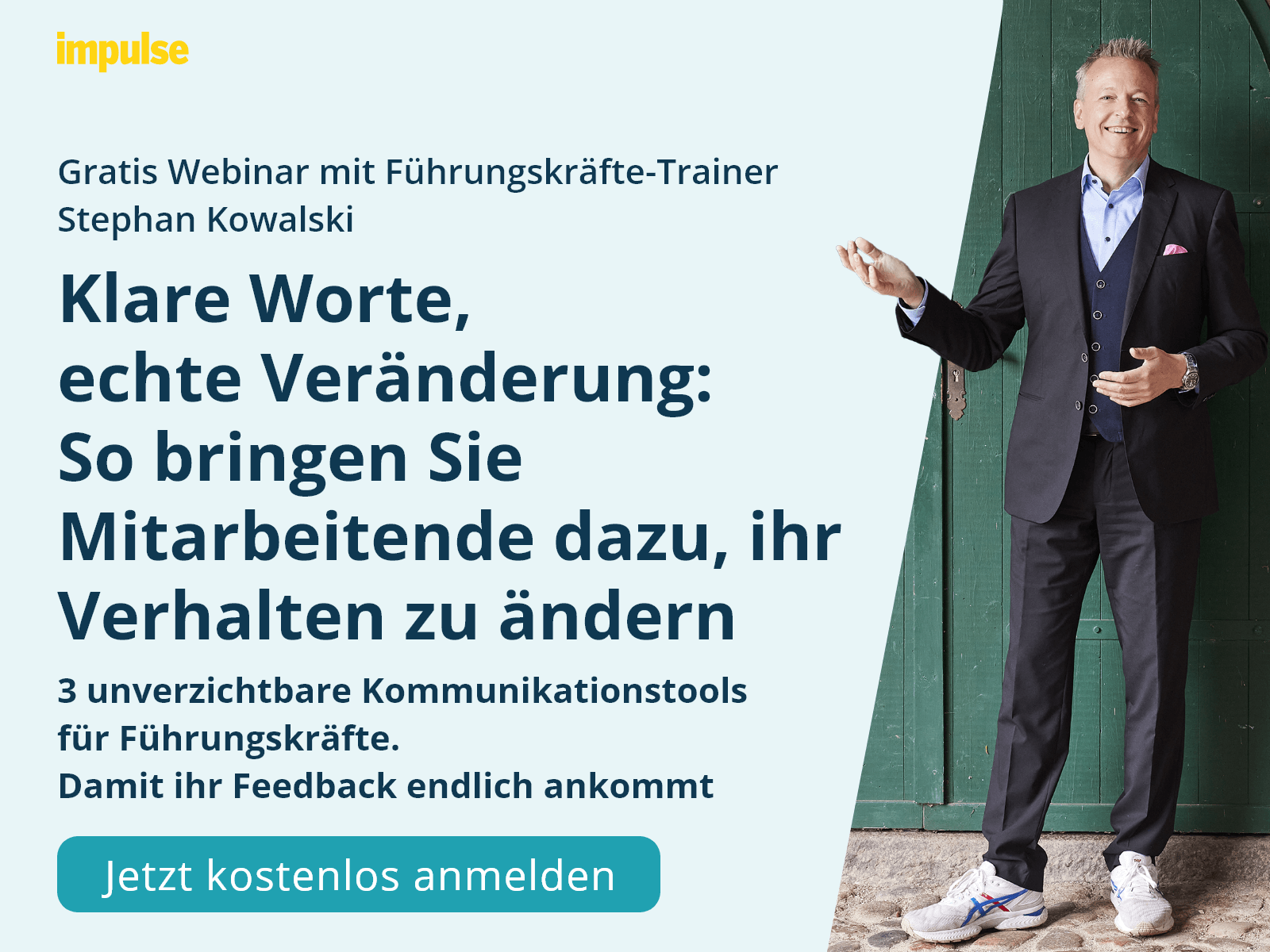Im Saal 14 des Oberlandesgerichts Stuttgart führt der Drogeriekönig Erwin Müller an diesem Spätjulitag einen einsamen Kampf, es ist ein Kampf gegen sich selbst. Achtmal hat Müller seinem ehemals ersten Mann Gerhard Kramer innerhalb weniger Monate gekündigt. Jedes Mal hat der dagegen geklagt – und gewonnen. Jetzt verhandelt das Stuttgarter Oberlandesgericht über Müllers Berufungen gegen die Annullierung der ersten sechs Kündigungen.
Wie zwei Fremde hocken die beiden Männer vor dem Richter. Gesprochen haben sie seit über einem Jahr nicht mehr miteinander. „Hinter der Geschichte steckt etwas, das wir nicht lösen können“, stellt der Vorsitzende Richter klar und wirbt für einen Vergleich. Für Müller eine Zumutung: „Ich bin kein Teppichhändler.“ Auch Kramer „will das durchziehen“. Ihre Fehde wird in dieser Verhandlung nicht beigelegt. Knapp zwei Monate später, am 24. September, schmettert das Oberlandesgericht die Berufungen ab. Und der nächste Gerichtstermin steht bereits fest: Am 1. Dezember wird das Stuttgarter Oberlandesgericht erneut verhandeln – über Müllers Berufung gegen die Annullierung von Kündigung Nummer sieben.
Es ist ein bizarrer Rechtsstreit, in dem es um Macht und Kontrolle geht. Und bei dem der 78-jährige Erwin Müller, einer der erfolgreichsten Unternehmer der Nachkriegsrepublik, seinen guten Ruf ruiniert, weil er an der Macht klebt. „Müller merkt gar nicht, wie sehr er sich damit schadet“, sagt ein hochrangiger Manager aus der Branche.
Dabei sah 1992 alles nach einem würdigen Abschied aus: Als Erwin Müller auf der Party zu seinem 60. Geburtstag über die eigene Zukunft fabuliert, klingt alles noch ganz leicht. Vor 400 Gästen kündigt der Unternehmer wie selbstverständlich den eigenen Ausstieg an: Mit 65 Jahren werde er die Firma nicht mehr betreten. Käme er weiter ins Büro, könne man ihn einen Lügner nennen, einen alten Esel, der es nicht lassen könne. 18 Jahre später kommt Erwin Müller noch immer in die Firma.
Immer wieder scheitern Patriarchen am eigenen Abgang: Sie schaffen Großes und setzen es leichtfertig aufs Spiel, weil sie nicht loslassen können: Der Glaube an die eigene Unfehlbarkeit, Größenwahnsinn, Angst vor dem Versinken in die Bedeutungslosigkeit und mangelndes Vertrauen in die Nachfolger machen sie zur größten Gefahr für das eigene Lebenswerk. In seiner späten Schaffenszeit wird manch Unternehmer zu seinem ärgsten Feind.
Dabei ist der eigene Abschied der ultimative Auftrag des Helden, die vielleicht schwierigste Aufgabe in der späten Karriere des Patriarchen: Sie verlangt von ihm, sich neu zu erfinden und einen neuen Lebenssinn zu suchen. „Ihre Tragödie ist, dass sie für sich selber nicht leisten können, was sie jahrelang so gut für ihre Firma getan haben: Zukunftsvisionen zu schaffen und diese zu realisieren“, sagt der Psychologe Otto Quadbeck, der zur Leere nach dem Arbeitsleben forscht. Stattdessen riskieren die Unternehmer, Schaden anzurichten und die Bewunderung zu verlieren, die sie so verzweifelt zu bewahren suchen.
Hinter dem oft beschworenen Nachfolgeproblem des deutschen Mittelstands verbirgt sich häufig ein „Vorgängerproblem“, glaubt Frank Wallau, stellvertretender Geschäftsführer des Bonner Instituts für Mittelstandsforschung. Unternehmer, die an der Macht kleben, halten selbst potenzielle Nachfolger aus der eigenen Familie oder aus dem Management auf Abstand. Das „Prinz-Charles-Syndrom“ nennt Wallau das.
Die wirtschaftlichen Folgen können fatal sein: „Der ganze Geschäftsbetrieb ist auf den Vorgänger optimiert, ganz besonders natürlich bei der Gründergeneration. Vieles läuft auf einer informellen kulturellen Ebene. Nichts ist festgeschrieben“, sagt Wallau. „Eine wahnsinnige Herausforderung für jeden Nachfolger.“ Wenn der denn überhaupt mal ran darf.
Der schleichende Tod
Wird der Generationenwechsel übermäßig hinausgezögert, drohe selbst lange erfolgreichen Unternehmen ein „schleichender Tod“, sagt Wallau: „Der Patriarch beharrt auf seinen nicht mehr zeitgemäßen Methoden. Nötige Veränderungen finden nicht statt, Investitionen und Reformen bleiben aus.“ Ein häufig kontrollierender Führungsstil verhindere, „dass Topleute im Management ihr Riesenpotenzial zum Einsatz bringen“. Stattdessen wandern die Besten ab, „wenn das Frustlevel erst mal hoch genug ist“. Der Abstieg kommt in Etappen. Irgendwann hat die Firma ein dickes Problem. Die Folgen lassen sich im deutschen Mittelstand vielfach besichtigen: bilanzielles Siechtum und im schlimmsten Fall die Übernahme durch einen Konkurrenten oder durch Finanzinvestoren.
Die bekanntesten Fälle sind längst Teil der Wirtschaftswunder-Legende. Carl Borgward etwa, der 1961 pleiteging, weil er niemandem außer sich selbst das Autobauen zutraute. Der Radiopionier Max Grundig, der nicht wahrhaben wollte, dass Fernseher in Asien billiger gebaut werden können. Alfons Müller-Wipperfürth, der in seinen Läden keine Mode akzeptierte, die ihm selbst missfiel (siehe auch Seite 18). Josef Neckermann, der sein Versandhaus an Karstadt andocken musste. Friedrich Jahn, der sich mit der weltweiten Expansion der Wienerwald-Restaurants verhob, oder Heinz Nixdorf, der von den Personal Computern aus dem Silicon Valley kalt erwischt wurde.
Tragödien, denen in der Regel eindrucksvolle Karrieren vorausgingen. So auch bei Erwin Müller. Sein Unternehmerleben begann der Drogeriechef im Jahr 1953 als Friseur in der Wohnung seiner Eltern. Aus dem Nichts schuf er eine Drogeriemarktkette. Mit 78 Jahren könnte er längst den Ruhestand genießen. Doch er führt seine Kette mit 600 Filialen und 23.000 Mitarbeitern immer noch selbst und verschleißt dabei Manager um Manager. Mit seinem Sohn Reinhard – lange für Vertrieb, Logistik, IT und Personal zuständig – hat sich der Senior bereits 2006 überworfen. Jetzt betreibt der Junior eine Schießhalle für Sportschützen.

| Männer, die nicht loslassen konnten |
|---|
| Zuerst wurden sie dafür bejubelt, dass sie alles richtig machten. Als die Zeiten sich änderten, war das Richtige plötzlich das Falsche. Und tödlich für ihr Unternehmen. Drei Fallbeispiele: |
| Alfons Müller-Wipperfürth m Nachkriegsdeutschland verkaufte Müller-Wipperfürth zeitlose Billigware. Die Preise hielt er durch den Verzicht auf Zwischenhändler. Der Kik der 50er-Jahre beschäftigte 8000 Menschen in 18 Fabriken. Seine Massenware passte in den 70er-Jahren nicht mehr zum Lebensgefühl der Deutschen, die seine charmefreien Läden zunehmend mieden. Müller-Wipperfürth mochte nicht umsteuern, 1982, da war er 71 Jahre alt, schloss das letzte seiner Geschäfte. |
| Carl F. W. Borgward Dem Autobauer verdankt Deutschland mit der Isabella eines der schönsten und mit dem „Leukoplastbomber“ Lloyd eines der skurrileren Autos der Wirtschaftswunderzeit. Erste Autos baute der 1890 geborene Borgward schon seit 1924 in Bremen. Ende der 50er-Jahre hatte er keine neuen Autos im Angebot, die den Publikumsgeschmack trafen. Anfängliche Qualitätsmängel beim Modell Arabella trieben die Firma innerhalb von zwei Jahren in die Insolvenz. |
| Max Grundig 1930 eröffnete Max Grundig in Fürth ein Radiogeschäft, das zur Keimzelle eines Konzerns für Unterhaltungselektronik werden sollte. Grundig bediente den Massenmarkt der 50er- und 60er-Jahre mit Radios und Fernsehern. In den 70er-Jahren baute er in Fürth eine riesige Fernseherfabrik, um ein Gegengewicht gegen Billigprodukte aus Asien zu bilden. Doch die Kunden dachten weniger national. Der 76-jährige Grundig verkaufte seine Firma 1984 an den Konzern Philips. |
Seit Oktober 2008 arbeitet sich Müller nun an Gerhard Kramer ab. Damals machte er den Fremdmanager zum Geschäftsführer für Einkauf und Vertrieb – zum wichtigsten Mann im Drogerieimperium und zum potenziellen Nachfolger. Doch schon nach wenigen Monaten zofften sich die beiden Männer. Müller mischte sich ein, Kramer protestierte. Müller entzog Kramer den Einkauf, der forderte Vertragstreue. Im April 2009 stellte Müller seinen Geschäftsführer frei, im Juli schickte er die erste Kündigung. Dann die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste, die siebte, die achte.
Dabei ist der Kleinkrieg mit Kramer nur einer der zahlreichen Schauplätze im Müller-Imperium: Ein Klima von Misstrauen und Kontrollwahn dominiert den Alltag. Trotz seines Alters geht der streitbare Schwabe keinem Krach aus dem Weg: Geradezu berüchtigt sind seine wöchentlichen Baubesprechungen, in denen sich der architekturaffine Müller die Pläne der bald zu eröffnenden Filialen zeigen lässt. „Ist da die Tür für den Sozialraum mal nicht an der Stelle, die Müller für richtig hält, flippt er aus“, berichtet ein Insider. „Sein Kontrollwahn ist grenzenlos.“
Der Überraschungsbesucher
Einen Tag in der Woche reserviert Müller traditionell für Überraschungsbesuche in Filialen. Was er dort vorfindet, ist Gesprächsthema in vielen der wichtigen Besprechungen, an denen er als oberste Instanz teilnimmt. „In diesen Sitzungen wird nur über Kleinigkeiten gesprochen“, sagt ein Manager, „die wirklich wichtigen Probleme werden oft totgeschwiegen.“
Müller riskiert derweil mit einsamen Entscheidungen den Erfolg seines Imperiums. Für Kritik ist er taub. Stattdessen herrscht er mit harter Hand. Ein Mitarbeiter berichtet: Gibt es während des Weihnachtsgeschäfts beispielsweise etwas mehr zu tun, wird dafür gesorgt, dass niemand zu früh nach Hause geht. Als Mitarbeiter eines Neu-Ulmer Lagers im April 2009 erstmals in der gut 50-jährigen Firmengeschichte einen Betriebsrat gründeten, existierte der nur zwei Wochen: Zum 1. Mai verkaufte Müller das Lager. Und war damit den Betriebsrat los.
Auch bei den Datenschützern des Stuttgarter Innenministeriums geriet Müller unlängst ins Visier. Wegen des rechtswidrigen Umgangs mit Krankendaten verdonnerten sie Müller Anfang des Jahres zur Zahlung von 137.500 Euro. Nahezu 20.000 Mitarbeiter der Drogeriekette seien von 2006 bis 2009 unzulässigerweise nach den Gründen für krankheitsbedingte Arbeitsausfälle befragt worden, monierten die Datenschützer. Was besprochen wurde, stand in manchen Fällen – ebenfalls rechtswidrig – hinterher in der Personalakte.
„Macht macht bitter und krank“, sagt der Psychoanalytiker Mario Erdheim. „Die Mächtigen leugnen, dass sie verletzlich sind.“ Je mächtiger ein Mensch sei, desto verletzbarer werde er jedoch, so der Experte. Mit der Macht steige auch das Misstrauen gegenüber der Umwelt. „Der Mächtige unterstellt jedem, er trage den Dolch im Gewande“, sagt Erdheim. „Das Gefühl, niemandem vertrauen zu können, führt zu einer Art Verfolgungswahn, und der Realitätsverlust schreitet voran.“
Unternehmer, die im Nachkriegsdeutschland groß geworden sind, klammern besonders an der Macht. Das hat Armin Pfannenschwarz, Leiter des Karlsruher Studiengangs Unternehmertum, beobachtet. Schon in seiner Dissertation beschäftigte er sich mit dem Thema. Seine empirisch gestützte These: Etliche Patriarchen haben während des Krieges extreme Erfahrungen gemacht. „Ihre Lebenserkenntnis ist, dass es keine Sicherheit im Außen gibt.“ Zum eigenen Schutz hätten sich darum etliche ihr eigenes kleines Reich aufgebaut, in dem sie als Herrscher für Gefolgschaft sorgen. Verlassen sie dieses im hohen Alter, breche der mühsam aufrechterhaltene Rahmen zusammen. „Urängste und Unsicherheiten, die sie ein Leben lang unterdrückt haben, kommen heraus“, sagt Pfannenschwarz, „unterbewusst klammern sie deswegen lieber an der Macht.“
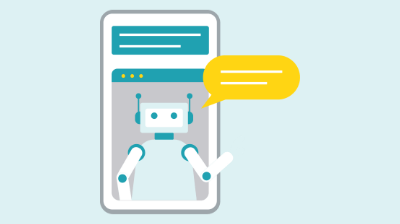
Etliche Kriegskinder sind noch im Amt. Zum Beispiel der Haribo-Chef Hans Riegel. Mit 87 Jahren denkt der Patriarch nicht ans Aufhören. Seit 1946 führt er die Bonbonfirma, bis zu dessen Tod im vergangenen Jahr gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Paul. Bis 2006 hatte Hans Riegel, selbst kinderlos, seinen Neffen Hans-Jürgen Riegel als Kronprinzen vorgesehen. Doch der zog sich nach einem Krach mit dem als eigenwillig bekannten Patriarchen überraschend zurück. Nach einigen Jahren der Stagnation kam erst jüngst erneut Bewegung in die Nachfolgedebatte. Der Unternehmer hat sich offenbar darauf eingelassen, sich mit seinen Neffen Hans-Guido Riegel als zweitem Geschäftsführer und Hans-Arndt Riegel als Vorsitzenden des neu gegründeten Aufsichtsrats abzustimmen.
Was ihn dazu bewogen hat, sagt er nicht. Hans Riegel hat auf die Anfragen von impulse ebenso wenig reagiert wie Erwin Müller.
Sie sind keine Ausnahme. Kaum ein Macher will über den Abschied von der Macht reden. Die meisten Unternehmer, bei denen impulse anklopft, finden für ein Interview keinen Platz im Terminkalender. Andere ziehen ihre Zusage wieder zurück. Fehlanzeige auch bei Beratern, die Unternehmer nach dem Ende der Berufslaufbahn coachen. Einer Kölner Expertin fallen spontan drei Klienten ein, die zum Thema viel zu sagen hätten. Ob sie zu einem Gespräch bereit sind, will sie ihre Kunden jedoch nicht einmal fragen. „Das sind Sturköpfe.“ Schon die Frage würden sie als Zumutung empfinden. „Warum sollten sie ihren Ruf ruinieren, indem sie öffentlich über Schwächen reden?“
Ringen um den gelungenen Abschied
Glaubt man Eugen Schwarzkopf, sind sich viele dieser Schwäche nicht einmal bewusst. „Als Chef steckt man mittendrin und findet, was man tut, ganz normal.“ Schwarzkopf spricht aus eigener Erfahrung. Der Gründer des Unternehmens Hotset, das im sauerländischen Lüdenscheid Heizelemente produziert, hat lange für seine Aufgabe gelebt. Er hat mit seinem Abschied gerungen, hat gelitten und den eigenen Ausstieg am Ende doch ohne Peinlichkeit für sich und das Publikum hinbekommen.
1972 gründet Schwarzkopf, der aus einfachen Beamtenverhältnissen stammt, die Firma. Aus dem Nichts. Mit nur einem Mitarbeiter. Die Geschäfte florieren. Schwarzkopf jettet durch die Welt, baut rasch ein Millionengeschäft auf. Er genießt seinen Status an der Spitze, er ist die Vaterfigur und Stimme der Firma. Seine „große Kunststofffamilie“ nennt Schwarzkopf noch heute seine Geschäftsfreunde. „Da bilden sich persönliche Beziehungen.“
Wie schwer der Abschied aus dieser Welt fällt, erfährt Schwarzkopf, als er nach 25 Jahren einen Burn-out hat. Er beschließt, das Geschäft an seinen Sohn abzugeben. Doch der Übergang gestaltet sich schwierig. Senior und Junior kämpfen jahrelang um die Ausrichtung. Der Junior will die Firma umkrempeln. Der Senior sträubt sich. „Ich wollte loslassen, konnte es aber nicht von heute auf morgen.“ Die Ehe des Vaters zerbricht über den Streitigkeiten. Nach sechs spannungsreichen Jahren gibt der Senior nach.
„Wie Selbstmord auf Raten“
Eugen Schwarzkopf bleibt zwar in der Firma, doch der Machtkampf ist entschieden. Die Insignien der Macht schwinden. Seine langjährige Assistentin übernimmt eine neue Aufgabe im Unternehmen. Der Senior fühlt sich aufs Abstellgleis verfrachtet. „Man ist da und doch nicht da, man bekommt viele Informationen, die man nicht mehr braucht, aber bei den eigentlich wichtigen Fragen hat man nichts mehr zu sagen. Das ist, als ob man Schritt für Schritt seine Identität abgibt, ein Selbstmord auf Raten, ein sehr schmerzhafter Persönlichkeitsverlust.“ Macht wirkt wie eine Sucht. Wer sie verliert, leidet unter Entzugserscheinungen.
Auch die Bindungen in der Kunststofffamilie erweisen sich als brüchig. Plötzlich fehlt das Verbindende. Schwarzkopf geht seine Visitenkarten durch und realisiert, dass 70 Prozent der bisherigen Kontakte nicht mehr vonnöten sind. „Es gab nichts mehr, worüber ich hätte mitentscheiden können, das hat viele Gespräche überflüssig gemacht.“
Als der Senior 2005 komplett aus dem operativen Geschäft aussteigt, fällt er in ein Loch. „Man weiß lange im Voraus, dass dieser Tag kommt, stellt sich mental darauf ein und wird doch umgehauen.“ Schwarzkopf weiß mit der neu gewonnenen Freiheit zunächst nicht viel anzufangen. Bislang war der Tagesablauf vorgegeben. „Mir wurde alles abgenommen, was nicht mit verantwortungsvollen Entscheidungen zu tun hatte.“ Plötzlich muss er sogar Briefmarken und Briefumschläge selbst kaufen. Für das Aufsetzen und Verschicken eines Briefs braucht er einen Tag. „Das Leben ist von heute auf morgen beängstigend unstrukturiert. Man fühlt sich wie ein hilfloser Anfänger.“
Es gibt immer wieder Phasen, in denen sich Schwarzkopf von der Außenwelt zurückzieht, „um wieder Boden unter den Füßen zu bekommen“. Er bastelt viel, er meditiert. Er besucht weiterhin Führungsseminare und fühlt sich fehl am Platz. „Ich war der älteste Teilnehmer, alle anderen waren mindestens 20 Jahre jünger, die Denke war komplett anders.“
Es dauert ein paar Jahre, bis er die Geschicke wieder selbst in die Hand nimmt. „Dann habe ich endlich geschafft, wieder in einen geordneten Vorwärtsgang zu schalten, statt mich von den Prozessen, die ich selber angestoßen hatte, treiben zu lassen.“ Rückblickend bezeichnet Schwarzkopf diese Phase als Neugeburt.
Heute hat der 69-Jährige seinem Alltag neue Strukturen verpasst. Montags wandert er mit Freunden, mittwochs und freitags geht er ins Fitnessstudio. Seine Gesundheit ist ihm wichtig. Seit einigen Jahren leidet er unter Herzflimmern, im Frühjahr diagnostizierten Ärzte eine angegriffene Magenwand. „Ich muss auf mich aufpassen.“ Er hat eine neue Partnerin, singt im Kirchenchor, kümmert sich um die vier Enkel und kämpft in einem Verein für den Ausbau der Kinderbetreuung durch Tagesmütter. „Da profitieren andere von meinen Managementerfahrungen.“
Ins Unternehmen fährt er nur noch selten, obwohl er „geistig selbst heute noch nicht ganz ausgestiegen ist“, sagt Schwarzkopf. „Da bleibt man immer irgendwie verbunden.“ Doch statt zu trauern, blickt Schwarzkopf in die Zukunft. Irgendetwas, prophezeit er, werde er immer tun, bis zum letzten Atemzug. Seine Großmutter starb 97-jährig, seine Mutter ist 93 Jahre. Schwarzkopf will mindestens 98 Jahre alt werden. „Da gibt es noch etliche Möglichkeiten, sich nützlich zu machen.“
„Patriarchen, die ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Eigenschaften woanders erfolgreich einbringen können, haben gute Chancen, den eigenen Ruhestand zu bewältigen“, sagt der Psychologe Otto Quadbeck. „Schwer hat es, wer die gewonnene Autonomie nicht zu nutzen weiß oder das Nichtstun nicht genießen kann.“ Quadbeck hat etliche Führungskräfte im Ruhestand befragt und dabei mitunter in Abgründe geblickt: Ein ehemaliger Vielflieger zog sich regelmäßig zum Trinken in einen ausgemusterten Erste-Klasse-Lufthansa-Sessel zurück, den er in seiner Bibliothek aufgestellt hatte. Ein anderer ging weiterhin täglich ins Büro, bis ihm sein Nachfolger quasi ein Hausverbot auferlegte.
Rund ein Drittel der Befragten war mit dem Wechsel in den Ruhestand nicht fertig geworden, sagt Quadbeck. Bei ihnen beobachtete er das Empty-Desk-Syndrom: Die Betroffenen fallen in ein tiefes Loch, ein Gefühl der inneren Leere, der Sinnlosigkeit und des Versagens. „Unausgeglichenheit und Frustration führen zu Streitsucht, zu sozialem Rückzug oder zu gesundheitlichen Problemen, Alkoholsucht, Depressionen, gar Suizid“, sagt Quadbeck.
Das prominenteste Beispiel: Als sich George Eastman, Gründer des US-amerikanischen Kameraherstellers Kodak, im Alter von 77 Jahren umbrachte, lautete seine Abschiedsnotiz: „Meine Arbeit ist erledigt, warum warten?“
Im Ruhestand rächt sich, dass Unternehmer ihren Heldenstatus häufig auf Kosten ihres Privatlebens erkämpft haben. Den Wechsel in eine neue Lebensphase empfinden sie als Gang ins Exil, das Klammern ans Weitermachen gleicht einem Kampf ums Überleben. „Sie fürchten, vergessen zu werden, und vermissen nicht selten die öffentliche Aufmerksamkeit“, sagt Quadbeck. Als Abhängige der Macht können sie nicht ohne Organisation und Untergebene leben, über die sie Macht ausüben.
Quadbeck weiß, wovon er spricht. Er zählt eigentlich selbst zur Risikogruppe des Empty-Desk-Syndroms. Als Bankdirektor stand der heute 70-Jährige lange an der Spitze verschiedener Finanzinstitute. Er beobachtete Weggenossen, die sich nach ihrem Abgang hängen ließen, seelisch und körperlich krank wurden. „So wollte ich nicht enden“, sagt Quadbeck. Mit 60 Jahren – seine Bank fusionierte mit einer anderen – verabschiedete er sich von der Macht, ging zurück an die Universität, studierte Psychologie und forschte. Jetzt will er Führungskräfte in Gruppenseminaren und in Einzelcoachings auf den Ruhestand vorbereiten.
Kleber und Loslassen-Könner
„Je weniger das Selbstwertgefühl von der Rolle im Unternehmen abhängt, desto größer die Chance, dass der Ausstieg gelingt“, glaubt Jeffrey Sonnenfeld. Der Yale-Professor unterscheidet beim Meistern des Übergangs vier unterschiedliche Typen: Monarchen und Generäle kleben an der Macht, Botschaftern und Gouverneuren fällt der Abschied leichter. „Welcher Typ man ist, hat nichts mit Branchen oder Führungsstilen zu tun“, so Sonnenfeld, „sondern mit dem Konzept der eigenen Person.“
So halten Monarchen sich für unersetzbar und gehen erst, wenn sie sterben oder aus dem Amt gejagt werden. Generäle treten ab, wenn sie müssen, warten jedoch auf das Scheitern des Nachfolgers, um „im Notfall“ und „zur Rettung der Firma“ auf den alten Posten zurückzukehren. Wie Monarchen sind sie eins mit ihrer Karriere und können ihr Lebenswerk nicht loslassen. Ihr Selbstwertgefühl hängt von äußeren Zeichen der Macht und Anerkennung ab. Beide Typen ignorieren die Notwendigkeit des eigenen Abtretens und blockieren jeden Schritt der Nachfolgeklärung. Sie haben sich jahrelang über ihre Rolle im öffentlichen Leben definiert, keine Vorbereitungen für den eigenen Ruhestand getroffen und wenig Lust, ihr brachliegendes Privatleben zu managen.
„Besonders in Familienunternehmen dominieren Monarchen und Generäle“, sagt Peter May, Chef von Intes, Akademie für Familienunternehmen. Sie sind enger mit dem Unternehmen verbunden als mit ihrer Familie und glauben, als Einzige den Erfolg der Firma sichern zu können. Sie kleben am Amt – besonders wenn (zumindest in ihren Augen) es an geeigneten Nachfolgern in der Firma fehlt. Oder weil sie sich nicht rechtzeitig finanziell von ihrem Lebenswerk abgenabelt haben. „Viele Unternehmer haben kein privates Vermögen aufgebaut“, so May. „Ihre Angst, Nachfolger könnten auch ihre Existenz bedrohen, lässt sie an dem Spitzenjob klammern.“
Dabei bieten gerade Familienunternehmen Patriarchen die Chance eines Abschieds auf Raten: „Selbst wenn sie im Alltagsgeschäft keine Rolle mehr spielen, können sie im Beirat mitwirken oder Sonderaufgaben übernehmen“, sagt May. Das ist der perfekte Rahmen für den Typ Unternehmer, den Yale-Professor Sonnenfeld als Botschafter charakterisiert: Sie planen ihren Abschied rechtzeitig, ohne jemals ganz zu gehen.
Dieter Knipping hat dieses Privileg bewusst genutzt. Vor fünf Jahren zog sich der Unternehmer aus dem operativen Geschäft seiner Kunststofftechnikfirma King Plastic zurück. Als Berater steht er seiner Tochter und Nachfolgerin jedoch bis heute zur Seite. „So musste ich nicht übergangslos aus dem Hochleistungssport aussteigen, sondern konnte über Jahre hinweg abtrainieren“, sagt Knipping „Das ist absolut gesundheitsbekömmlich.“
Der 70-Jährige sitzt hinter seinem schweren Büroschreibtisch. Er ist seit 7 Uhr auf den Beinen, seit 10 Uhr in der Firma. Wie fast jeden Tag. „Nur darum bin ich noch verheiratet“, sagt Knipping, „Zu Hause würde ich verrückt und meine Ehefrau mit mir.“
Stattdessen kommt er in die Firma, um seine Post zu erledigen und täglich ein paar Stunden in die Vergangenheit abzutauchen. In seinem Büro hat er alles an seinem Platz gelassen: den Schreibtisch, das Stehpult, die Eisenbahnlokomotive und die Bronzestatue. „Dieses Umfeld ist mein zweiter Anzug“, sagt Knipping. Ohne ihn fühle er sich nackt. Ein Leben ohne die Firma ist für ihn unvorstellbar.
Knipping sagt, er habe das Geschäft „mit der Muttermilch eingesogen“. Sein Vater hat das Unternehmen gegründet, die Familie wohnte in einer Wohnung im Dachstuhl des Fabrikgebäudes. Urlaub bedeutete, die Eltern auf auswärtigen Geschäftsterminen zu begleiten. Das Geschäft hatte immer Vorrang.
23 Jahre alt ist Knipping, als sein Vater stirbt. Er steigt in die Firma ein und ist ständig unterwegs. Nur am Sonntag erlaubt er sich „den Luxus“ eines gemeinsamen Familienfrühstücks, dann ist er wieder auf Reisen. Er pflegt keine Hobbys, hastet auch im Ausland von Termin zu Termin, ohne jemals etwas vom Land zu sehen. „Ich war echt bescheuert.“
Trotz seiner „Pflicht zur Arbeit“ beschäftigt er sich früh mit seiner Nachfolge. „Ich wollte zum Wohl der Firma schauen, ob es ohne mich geht.“ Nachdem der Senior seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, holt er Fremdmanager ins Unternehmen. Der Versuch missglückt. Parallel zu Knippings Rückzug fällt die Mauer, die Wiedervereinigung lässt das Geschäft einbrechen, die Fremdmanager suchen das Weite.
„Was mache ich da eigentlich?“
Knipping kommt 1992, drei Jahre nach seinem Ausstieg, zurück. Gemeinsam mit einem neuen Fremdmanager stellt er „das Unternehmen wieder auf sichere Beine“ – und bereitet seinen zweiten Ausstieg vor. Eine seiner zwei Töchter steigt mit ins Unternehmen ein. Gemeinsam strukturieren sie die Firma neu. „Zum ersten Mal habe ich mir bewusst gemacht, was ich eigentlich wie mache“, sagt Knipping. Er teilt sein Wissen, führt nachvollziehbare und verbindliche Prozesse ein, entwickelt mit seiner Tochter strategische Ziele, definiert präzise Ergebnisvorgaben und etabliert ein Risikomanagement, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen. 1998 gibt Knipping das operative Geschäft an den Fremdmanager ab. Knipping hat ihn geschäftlich beteiligt, bevor er sich zurückgezogen hat. „Diesmal wollte ich sicher sein, dass die Strukturen für den Fortbestand der Firma so gut wie möglich sind, bevor ich aussteige.“
Das Geschäft läuft seit Jahren, „als ob ich nicht mehr da wäre“, sagt Knipping. Nur auf der Weihnachtsfeier meldet sich der Senior immer noch offiziell mit einer Rede zu Wort. Ansonsten wird er aktiv, wenn seine Tochter, die sich um die Strategie kümmert, ihn in kritischen Situationen um Rat bittet.
Ihre Büros liegen direkt nebeneinander. Manchmal hört der Senior, wie seine Tochter langjährige Geschäftspartner am Ende eines Gesprächs fragt, ob sie noch mit ihrem Vater sprechen wollen. „Mein größtes Vergnügen ist, wenn sie Nein sagen“, sagt Knipping. „Dann bin ich sicher: Ich habe mich erfolgreich überflüssig gemacht.“
Für seinen zweiten Rückzug hat Knipping sich feste Altersgrenzen gesetzt und im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Vor fünf Jahren, mit 65, reduzierte er sein Arbeitspensum deutlich auf maximal fünf Stunden täglich. Kürzlich hat der 70-Jährige alle Beirats- und Aufsichtsratsmandate abgegeben. „Ich will aufhören, bevor ich anfange zu schwafeln.“
Diese Art von Selbsterkenntnis ist eher rar. Wo es an Freiwilligkeit mangelt, hilft nur Zwang. Deshalb führen zunehmend mehr Unternehmen Altersgrenzen für ihre Führungskräfte ein. Beim Vorstand gilt in den meisten Fällen 65 Jahre, bei Aufsichtsräten sind es 70 oder 72, bei Henkel gar 75 Jahre.
Grundlage dieser Grenzen ist der 2002 verabschiedete Corporate-Governance-Kodex, der Regeln für eine transparente und gute Unternehmensführung aufstellt. Den Passus, wonach Unternehmen für „Topmanager Altersgrenzen festlegen sollen“, akzeptieren fast alle Unternehmen inzwischen. Die Umsetzung ist jedoch freiwillig.
Bloß nicht persönlich nehmen
Intes-Chef Peter May sieht einen Vorteil der Grenze darin, dass sie nicht als persönliches Misstrauen fehlgedeutet werden kann – sie gilt ja für alle. „Für die Betroffenen erleichtert die starre Grenze, dem Lebensalter mit Würde und Anstand zu begegnen“, sagt May. „Sie erzwingt den Generationswechsel und signalisiert dem Mann an der Spitze und potenziellen Nachfolgern: Niemand ist prinzipiell unersetzbar, jeder muss einmal abtreten.“
Ohne solche äußeren Grenzen verneinen Unternehmer gern die eigene Vergänglichkeit, ignorieren die ersten Zeichen der eigenen Schwäche und verdrängen die Vorbereitung auf den Ruhestand. „Dieser Lebensabschnitt zählt immer noch zu den Tabuthemen“, sagt Psychologe Quadbeck. „er markiert den Beginn der letzten Phase vor dem Tod.“ Dies nicht auszublenden erfordert Stärke.
Stärke, die Klaus Tschira hat. Bei dem SAP-Mitbegründer hat der Gedanke an die eigene Sterblichkeit den Abschied von der Macht vielmehr beschleunigt. Tschira ist Anfang 50, als er durch einen Vortrag an der Eliteuniversität Harvard lernt, dass die Sterblichkeitsrate von Menschen, die nach dem Ausstieg aus dem aktiven Erwerbsleben in ein Loch fallen, um 1500 Prozent steigt.
„Das bringt einen zum Nachdenken“, sagt der 69-Jährige und zuckt die Achseln. Der Milliardär sitzt in seinem Büro in der Villa Bosch in Heidelberg: Brille, Bäuchlein, ein gepflegter Bart – „Braun-Bartschneider Stufe drei“ –, bequeme Bär-Schuhe, hellgrüne Krawatte, darauf „Auszüge aus den Notizen, die Physik-Nobelpreisträger Klaus von Klitzing bei der Entdeckung des Quanten-Hall-Effekts machte“.
Tschira gluckst, während er ins Plaudern kommt. Über seinen Jugendtraum, Physik-professor zu werden. Über seine Stiftung, die Naturwissenschaften unterstützt, und über seinen Ausstieg bei der 1972 gegründeten Softwareschmiede SAP. „Mit Informatik und Betriebswirtschaft habe ich mein Geld verdient“, sagt Tschira, „aber meine ältere Liebe gehört immer noch den Naturwissenschaften und der Mathematik.“
Seinen alten Job als Vorstand bei SAP vermisst Tschira „nicht die Bohne“. Was ihn wirklich interessiert – „mit Entwicklern zusammensitzen zum Beispiel“ – blieb allzu häufig auf der Strecke. Stattdessen musste er weltweit „Kunden betreuen“. Häufig war er auf Achse. „Ich habe alle Kontinente außer der Antarktis besucht“, sagt Tschira. Dennoch kennt er von der Welt „nur das Innere unzähliger Rechenzentren und Besprechungsräume“. Im Flughafen blieb maximal noch Zeit für einen Abstecher in den Buchladen, um sich ein Kochbuch über die lokale Küche zu besorgen. Von seiner Frau, die ihn oft begleitete, erfuhr Tschira, was er verpasst hatte.
„Natürlich habe ich den Erfolg auch genossen“, sagt Tschira. Doch der Ruhm lässt ihn auch früh über das eigene Ende nachdenken. „Ich hatte die Sorge, mein Tod könnte meine Familie ins finanzielle Desaster stürzen.“ Von seinem Vermögen hält Tschira das meiste in Form von SAP-Aktien. Müssen seine Erben zur Begleichung der Erbschaftsteuer in großem Stil Aktien verkaufen, so seine Sorge, könnte der Kurs genau deshalb dramatisch einbrechen. Tschiras schlimmste Vorstellung: Das Vermögen wäre futsch und die Erben trotzdem beim Finanzamt verschuldet.
Tschira reagiert, gründet Mitte der 90er-Jahre eine gemeinnützige Stiftung und bringt gut die Hälfte seines Aktienvermögens ein. 1998 wechselt der Gründer nach 26 Jahren aus dem operativen SAP-Geschäft in den Aufsichtsrat. Plötzlich hat er Zeit, über die er selbst verfügen kann. Für ihn „ein immenser Freiheitsgewinn“. Ihn stört weder der Machtverlust noch der Rückzug aus der Öffentlichkeit. „Nur das Gefühl, im Wettbewerb zu gewinnen, fehlt mir ab und zu.“
Er sei ein Einzelgänger, sagt Tschira. Es gebe viele Menschen, denen er sich freundschaftlich verbunden fühle, aber Freunde? Kaum. „Man weiß nie, ob die Leute mich als Menschen meinen oder mein Geld.“ Er ist misstrauisch geworden in den Jahren. Nach einer Veranstaltung in der Aula der Karlsruher Universität steckten ihm auf den rund 20 Metern zwischen Hörsaaltür und Gebäudeausgang gleich vier Menschen Anträge für Fördergelder zu, die sie „rein zufällig dabeihatten“. So etwas ist Tschira „peinlich bis lästig“.
Heute arbeitet er täglich zehn Stunden für die Klaus Tschira Stiftung, die Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik fördert. Selbst am Wochenende kommt er für ein paar Stunden ins Büro der Villa Bosch. Die schwierigen Anträge von Forschungsinstituten für Projektgelder landen auf seinem Schreibtisch, er sitzt im Kuratorium verschiedener Max-Planck-Institute und hat etliche Ämter an Universitäten und Hochschulen.
Doch Tschira genehmigt sich mehr Auszeiten. Gerade kommt er von einem knapp fünfwöchigen Urlaub aus Neufundland zurück. Er hat dort an seinen Memoiren geschrieben. Vor drei Jahren hatte er eine schwere Herzoperation. Sein Albtraum ist es, nach einem Herzinfarkt oder Schlaganfall auf dem Weg ins Klinikum im Stau stecken zu bleiben. Ob er Angst vor dem Tod hat? Nein, sagt Tschira, nur vor einem langen Siechtum.
Ab und zu telefoniert er mit einigen der SAP-Mitgründer. Seitdem Tschira 2007 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist, verfolgt er die Entwicklungen von SAP nur noch in der Zeitung. SAP hat sich verändert. Als Tschira aus dem operativen Geschäft ausstieg, hatte der Konzern 13.000 Mitarbeiter, heute sind es weltweit mehr als 60.000. Fährt er mal nach Walldorf, trifft er nur noch „den einen oder anderen alten Herrn“. Ein paar Mal war er beim Klub alter SAPler zum Abendessen. Neulich haben sie ihn zu einer gemeinsamen Wanderung eingeladen. Er weiß noch nicht, ob er mitgeht. Die gewählte Strecke scheint ihm zu hügelig. „Das ständige Auf und Ab liegt mir nicht“, sagt Klaus Tschira, „das Laufen auf einer Höhenlinie ist mir lieber.“