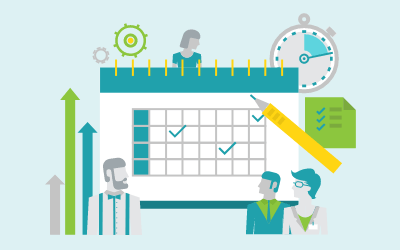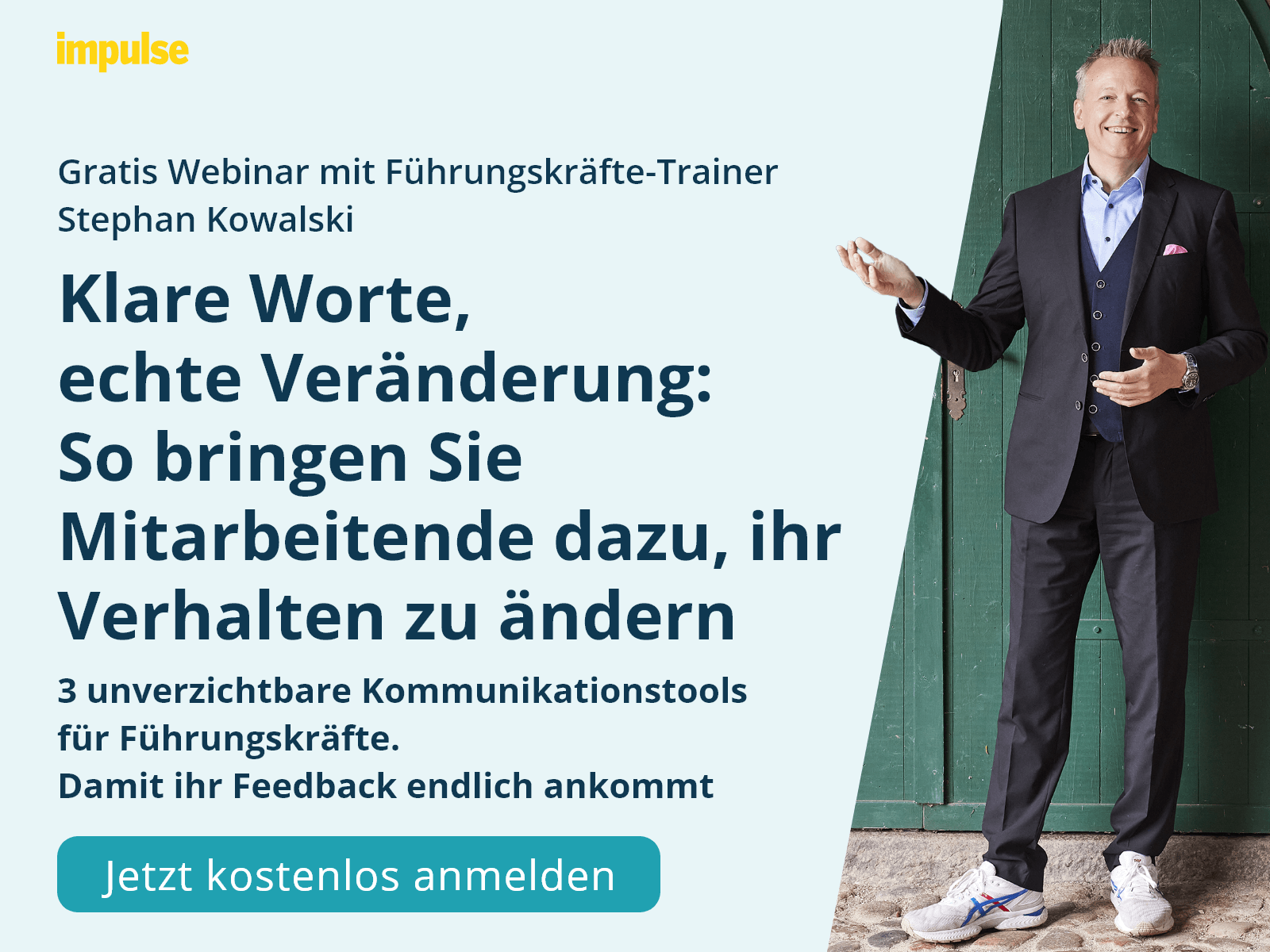Als Ingenieur bei Infineon hatte sich Fritz Volkert der Entwicklung von Thermoelektrik-Chips verschrieben. Die liefern allein durch Abwärme etwa in Funksensoren die Energie, für die man sonst wartungsintensive Batterien benötigt. Nach Jahren der Arbeit erreichten Volkerts Chips eines Tages Marktreife – und aus dem Ingenieur wurde ein Geschäftsmann.
Zusammen mit Kollegen gründete er 2006 im Rahmen eines Management-Buyouts (MBO, siehe Glossar unten) die Firma Micropelt. Allerdings kam das notwendige Kapital nicht von ihm selbst, sondern von Wagnisfinanzierern wie der Tübinger SHS Beteiligungsgesellschaft, der L-Bank Baden-Württemberg und der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Diese Gesellschaften halten bis heute die Mehrheit an Volkerts Freiburger Gesellschaft, benötigen aber die Fachkenntnis des Ingenieurs und seiner Kollegen. Führungskräfte wie er haben das technische Wissen, sie kennen den Markt ebenso wie die Kunden und sind darum nur sehr schwer zu ersetzen. Deshalb haben die Micropelt-Finanziers dafür gesorgt, dass die Gründer um Volkert bei der Stange bleiben: Mit kleinen Gesellschaftsanteilen haben sie die Truppe zu Mitunternehmern gemacht.
Ein durchaus übliches Vorgehen, wenn ein Finanzinvestor mit von der Partie ist. Steigt ein solcher Geldgeber ins Unternehmen ein, übernimmt er normalerweise die Mehrheit: 90 Prozent und mehr sind häufig. Den Managern wird ihr Engagement mit einem kleinen Gesellschaftsanteil von drei bis fünf Prozent versüßt – daher auch der Name Sweet Equity. Gewährt der Hauptinvestor ihnen zudem noch Aktionärsdarlehen, hat die Führungsriege bei guter Leistung äußerst attraktive finanzielle Aussichten: Sie ist damit auch an der Wertsteigerung „ihrer“ Firma beteiligt.
Vorsicht Steuer!
Von diesen süßen Geschenken möchte neuerdings aber auch das Finanzamt profitieren. Es prüft bei solchen Deals verstärkt, ob Schenkung- oder Lohnsteuer fällig werden. „Schenkungssteuer kommt aber in der Regel nur in Betracht, wenn vergünstigte Firmenanteile an Familienangehörige übertragen werden“, sagt Dirk Koch, Steuerberater und Rechtsanwalt bei der Kanzlei GSK Stockmann in Stuttgart. Bei Übertragungen zwischen Fremden nimmt der Fiskus nicht an, dass sich irgendjemand etwas schenkt.
Weitaus kritischer ist die Lohnsteuer. Das Amt kontrolliert, ob den Managern von ihrem Arbeitgeber ein geldwerter Vorteil zugeflossen ist – die Differenz zwischen dem verbilligten Preis des erworbenen Anteils und dessen Verkehrswert. Das ist nicht bei allen so: Eine bayerische Internetfirma, die ihrem Manager einen ganz normalen Anteil überließ, der mehr als 50 Prozent unter dem Verkehrswert dotiert war, geriet deswegen ins Visier der Finanzbeamten. Der Grund: Die Gesellschaft hat darauf prinzipiell Lohnsteuer sowie Soli einzubehalten und abzuführen – das hatten die Bayern versäumt.
Management-Buyins und Private Equity
Allerdings lässt sich daran schrauben, dass die Steuerlast niedriger ausfällt. Denn der zu versteuernde Vorteil sinkt, wenn die Anteile der Manager anders ausgestaltet sind als die der Private-Equity-Firma. „Hat der Investor mehr Rechte als die neuen Mitgesellschafter, etwa bei der Dividende“, sagt Dirk Koch, „ist es für das Finanzamt nicht einfach, den genauen Vorteil auszumachen und zu beziffern.“
Das gleiche Problem hat die Finanzverwaltung, wenn die Manager die Aussicht auf eine Beteiligung erhalten, diese aber erst später erwerben können. Mindestens ein Jahr nach dem Einstieg des Investors gibt es für den Anteil keinen festgezurrten Verkehrswert mehr. Dann muss sich das Finanzamt mit der Wertermittlung über komplizierteste Ertragswertverfahren behelfen. Allein die Problematik, welcher Zinssatz für die langfristige Verzinsung künftiger Firmenerträge anzusetzen ist, ist in größeren Firmen eine Millionenfrage. Diese Rechtsunsicherheit lässt sich trefflich als Trumpf gegen das Finanzamt ausspielen, sagt Anwalt Koch. „Da steckt jede Menge Verhandlungsspielraum drin.“
Zu solchen Verhandlungen dürfte es in den nächsten Jahren deutlich häufiger kommen, erwarten Experten. Das Institut für Mittelstandsforschung in Bonn schätzt, dass bis 2014 jährlich in gut 22.000 Unternehmen ein Nachfolger die Geschäfte übernehmen muss, weil der aktuelle Chef aus Altersgründen aufhört. Da längst nicht immer ein qualifiziertes Familienmitglied bereitsteht oder willens ist, den Betrieb weiterzuführen, kommt häufig nur eine externe Lösung infrage. „Das gibt oft den Anstoß, um eine Private-Equity-Firma anzusprechen“, sagt GSK-Rechtsanwältin Anne de Boer. Und die Investoren werden die Gelegenheit nicht vorüberziehen lassen, sich in ein ertragsstarkes Familienunternehmen einzukaufen.
Damit dürfte gleichzeitig auch mehr Sweet Equity verteilt werden. Denn Private-Equity-Investoren bedienen sich dieser Süßigkeiten auch, um externe Führungskräfte im Rahmen eines sogenannten Management-Buyins (MBI) zu engagieren. „Sehr viele Firmendeals mit Finanzinvestoren enthalten solche Bonbons“, sagt Anwältin de Boer.
Investor kann mit Darlehen aushelfen
Haben die Manager selbst zu wenig auf der hohen Kante, um sich an ihrem Unternehmen zu beteiligen, kann der Investor mit einem Darlehen aushelfen. „Der Kredit muss allerdings einem Fremdvergleich standhalten“, sagt Henning Bloß von der Frankfurter Wirtschaftskanzlei Heymann & Partner. Sind die Konditionen zu günstig, etwa im Vergleich mit denen der Hausbank, hat das Finanzamt wieder einen Grund, um Steuern zu fordern.
Doch auch zu normalen Konditionen ist die Darlehenslösung für die neuen Miteigentümer attraktiv, wenn es zum Leverage-Effekt kommt: Erzielt die Firma eine höhere Gewinnquote, als der Geldgeber an Zinsen für das Darlehen verlangt, steigt der Ertrag des tatsächlich eingesetzten Kapitals steil an.

Fritz Volkert, der Gründer von Micropelt, schweigt zwar über die Details seines Deals mit den Investoren, scheint aber alles richtig gemacht zu haben – denn über Probleme mit dem Finanzamt klagt er nicht. Probleme mit seinen Chips hat er ebenso wenig: Mitte des vorigen Jahres hat er in Halle an der Saale die weltweit erste Großserienfertigung gestartet.
Formen der Managementbeteiligung
- MBO: Als Management-Buyout bezeichnet man den Erwerb einer Firma durch das bisherige Management.
- MBI: Von Management-Buyin spricht man, wenn ein Unternehmen durch ein externes Management übernommen oder die Übernahme mithilfe eines Investors durch ein fremdes Management forciert wird.
- Private Equity: So nennt man Beteiligungskapital überwiegend institutioneller Anleger, das zumeist in nicht an der Börse gehandelte Unternehmen investiert wird.
- Leverage-Effekt: Zu Deutsch „Hebeleffekt“ – kleine Ursache, große Wirkung: So kann durch den Einsatz von Fremdkapital die Eigenkapitalrendite einer Investition gesteigert werden.