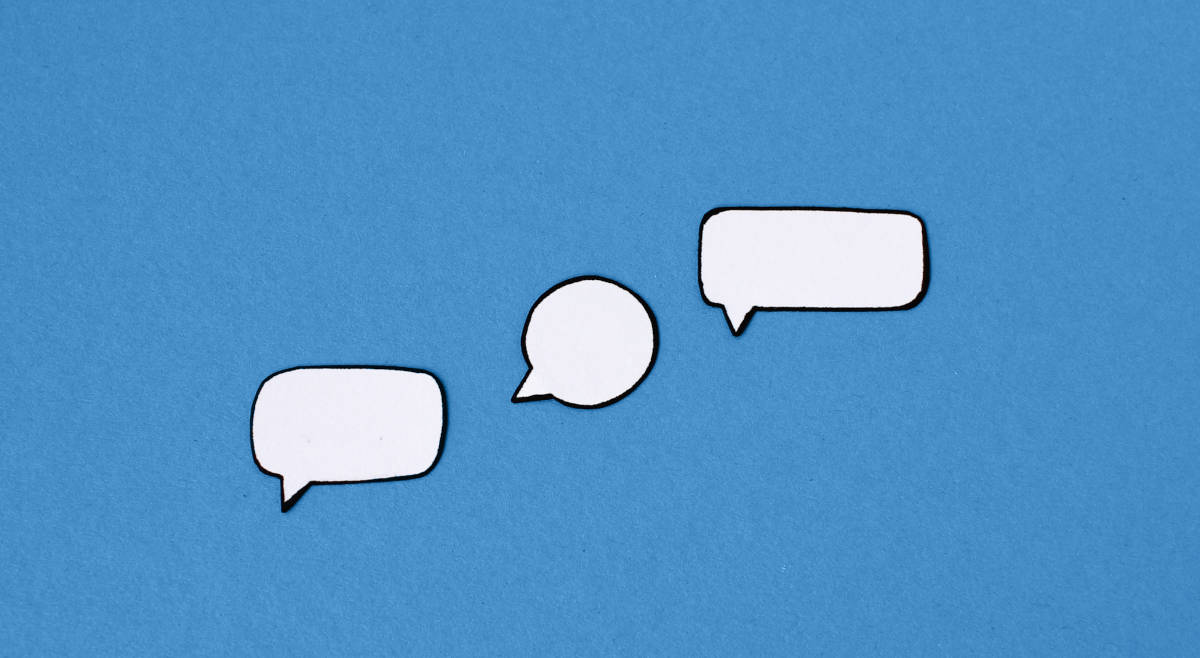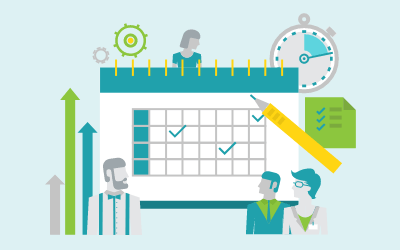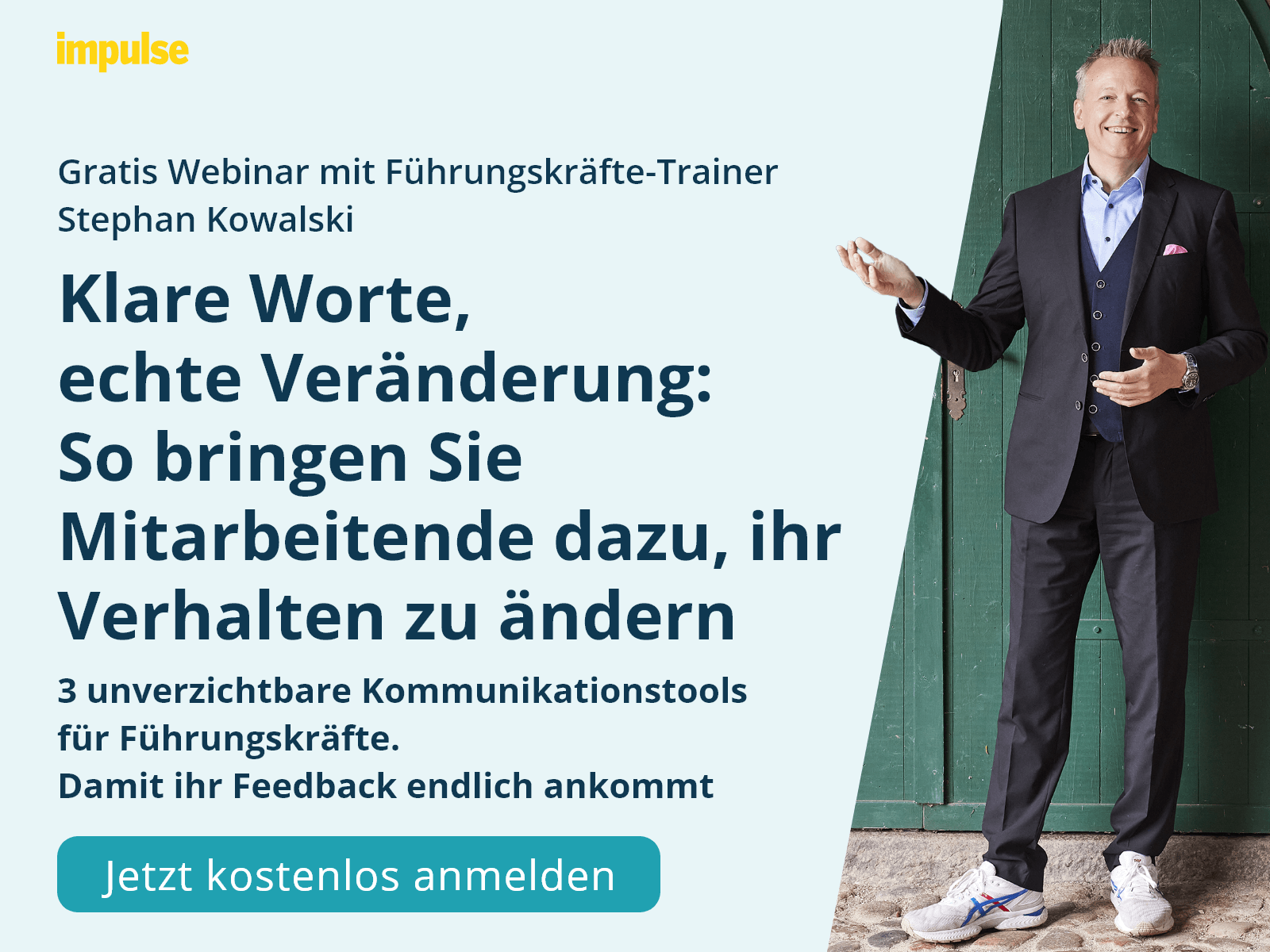Eltern sagen ständig Sätze wie „Wenn du deine Jacke nicht anziehst, wirst du krank“ – und erreichen damit in den seltensten Fällen, dass ihre Kinder sich wärmer anziehen. Doch auch bei Erwachsenen scheinen Warnungen und Drohungen nicht besonders erfolgreich zu sein.
Ein unappetitliches Beispiel gefällig? Obwohl in vielen Restaurants neben dem Waschbecken Schilder hängen wie: „Mitarbeiter müssen sich die Hände waschen“, waschen sich laut einer Studie aus den USA 62 Prozent der Angestellten in Gastro-Betrieben nicht die Hände, nachdem sie auf der Toilette waren.
Was läuft da falsch? Die US-amerikanische Neurowissenschaftlerin und Psychologin Tali Sharot beschäftigt sich in ihrem Buch „Die Meinung der anderen“ mit diesem Phänomen. Ihre These: Bei dem Versuch, andere zu beeinflussen, verfallen wir regelmäßig in Automatismen, die den Prozessen des menschlichen Gehirns nicht gerecht werden.
Mit schlimmen Konsequenzen drohen bringt nichts
Warnschilder und beispielsweise auch Überwachungskameras stehen für einen solchen menschlichen Reflex: Wenn wir wollen, dass jemand sein Verhalten ändert, machen wir ihm Angst und drohen mit schlimmen Konsequenzen.
Wie wenig diese Strategie hilft, konnten etwa Wissenschaftler der New York State University zeigen. Sie montierten auf der Intensivstation eines Krankenhauses insgesamt 21 Überwachungskameras, die alle Waschbecken im Blick hatten. Die Überwachung lief nicht heimlich ab, alle Mitarbeiter wussten Bescheid. Trotzdem hielt sich nur einer von zehn an die Vorschriften in Sachen Händewaschen.
Positive Anreize motivieren eher zum Handeln
Mehr Erfolg hatten die Wissenschaftler mit einer positiveren Versuchsanordnung: Sie statteten jedes Zimmer mit einer elektronischen Anzeigetafel aus, die unmittelbar Rückmeldung gab. Jedes Mal, wenn sich jemand die Hände wusch, erschienen auf der Anzeige ein Plus und ein individueller positiver Kommentar, etwa: „Sie machen das sehr gut“.
Der Effekt war enorm: Mehr als 90 Prozent der Beschäftigten hielten sich nun an die Vorschriften. Statt mit einer Drohung („Wenn ihr euch nicht richtig die Hände wascht, breiten sich Krankheiten aus“), brachte man die Mitarbeiter mit promptem positivem Feedback dazu, die Anweisungen zu befolgen.
 Tali Sharot: Die Meinung der Anderen. Wie sie unser Denken und Handeln bestimmt – und wie wir sie beeinflussen. Hardcover, 304 Seiten. Siedler, 14,99 Euro.
Tali Sharot: Die Meinung der Anderen. Wie sie unser Denken und Handeln bestimmt – und wie wir sie beeinflussen. Hardcover, 304 Seiten. Siedler, 14,99 Euro. Warum positive Anreize so gut wirken
Tali Sharot schreibt dazu: „Geht es darum, jemanden zum Handeln zu bewegen, ist unmittelbare Belohnung unter Umständen sehr viel effizienter als eine in Aussicht gestellte Bestrafung in ferner Zukunft.“ Und sie erklärt auch, warum diese Strategie erfolgreicher ist: durch die Vorwegnahme des wohligen Gefühls, das sich bei unmittelbarem positivem Feedback einstellt.
Klar: Jeder wird gern gelobt. Und so motiviert die Aussicht darauf Menschen eher, sich die Hände ordentlich zu waschen, als die Furcht davor, mit ungewaschenen Händen eventuell Keime zu verbreiten.
Heißt das für Unternehmer, dass sie von nun an mit Lob um sich schmeißen sollen? Nein. Weitere Studien haben gezeigt: Ein direktes positives Feedback muss nicht auf Dauer gegeben werden, damit Mitarbeiter ihr Verhalten ändern. Irgendwann wird das neue Verhalten nämlich zur Gewohnheit.
So bringen Sie Ihr Team dazu, richtig ranzuklotzen
Die Erkenntnisse der Psychologin lassen sich auf verschiedene Situationen im Arbeitsalltag übertragen – und dafür sind nicht zwangsläufig elektronische Anzeigetafeln nötig, die die Mitarbeiter anfeuern.

Ein Beispiel: Unternehmer Krause steht unter Druck. Ein wichtiger Kunde droht, die Geschäftsbeziehungen abzubrechen, falls er es nicht schafft, die Kosten für ein Projekt im nächsten Monat um 20 Prozent zu kürzen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss sein Team richtig ranklotzen.
In so einer Situation würden die meisten Chefs vermutlich eine Brandrede wie diese halten: „Leute, es sieht ziemlich schlecht für uns aus. Wir werden unseren wichtigsten Kunden verlieren, wenn wir es nicht schaffen, das Budget um 20 Prozent zu kürzen. Wir müssen alles geben, um das zu verhindern.“
Unternehmer Krause aber geht anders vor. Er versammelt sein Team und sagt: „Wir stehen vor einer großen Herausforderung. Wir müssen es schaffen, das Budget unseres Klienten um 20 Prozent zu kürzen, damit wir ihn halten und ordentlich Geld mit ihm verdienen können.“ Dieses Ziel schreibt Krause groß auf eine Tafel im Aufenthaltsraum – und notiert jeden Tag gemeinsam mit den Mitarbeitern auf dieser Tafel, wie weit sie schon gekommen sind.
So kann sich das Team jeden Tag über Fortschritte freuen, die eintreten, wenn es sich richtig reinhängt. Statt mit einem Schreckensszenario zu drohen („Der Kunde verlässt uns“), hat Krause es geschafft, die Mitarbeiter mit positiven Anreizen (dem Dokumentieren der Fortschritte) zum Handeln zu motivieren. Seine Methode, schreibt Tali Sharot, ist erfolgsversprechender, weil sie besser an die Funktionsweise des menschlichen Gehirns angepasst ist.
Wann Drohungen dennoch etwas bringen
Sind Drohungen also generell sinnlos? Nicht ganz. Es gibt Situationen, in denen es sehr effektiv sein kann, mit schlimmen Konsequenzen zu drohen. Nämlich immer dann, wenn man will, dass jemand etwas nicht tut.
Wer zum Beispiel verhindern möchte, dass seine Mitarbeiter vertrauliche Informationen preisgeben, sollte ruhig weiterhin deutlich machen: „Wenn du das tust, bist du sofort deinen Job los!“ Eine solche unmittelbare Bedrohung, erklärt Neurowissenschaftlerin Sharot, kann uns nämlich dazu bringen, zur Salzsäule zu erstarren – und gar nicht erst tätig zu werden.