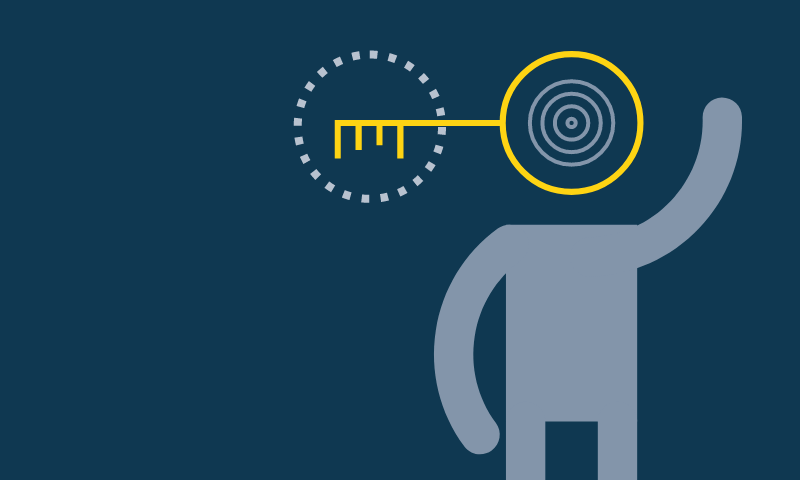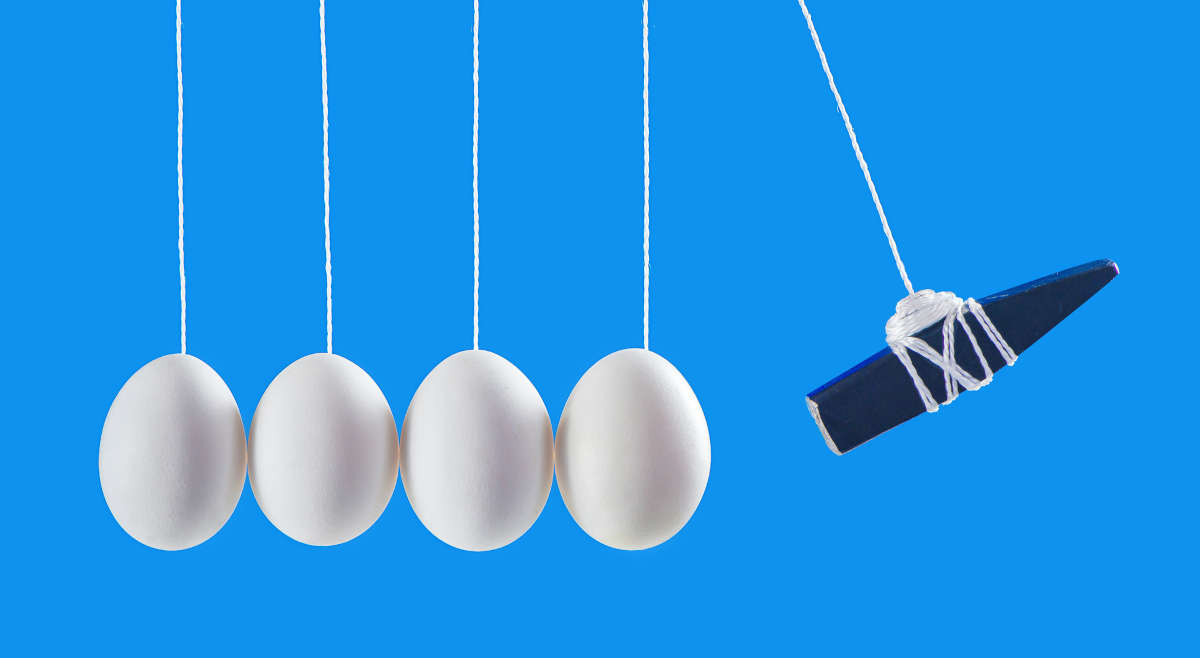Kriege, Krankheiten, Katastrophen und andere Krisen ziehen sich durch die Geschichte der Menschheit. Ewald Frie, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Tübingen, hat in einem großen Forschungsprojekt mit anderen Historikern untersucht, wie Menschen in der Vergangenheit mit Bedrohungen umgegangen sind. Im Buch „Krisen anders denken“ berichten Frie und seine Kollegen über ihre Erkenntnisse.
impulse: Die Unterzeile Ihres Buches lautet „Wie Menschen mit Bedrohungen umgegangen sind und was wir daraus lernen können“. Warum lohnt sich der Blick in die Vergangenheit?
Ewald Frie: Unserer Ansicht nach vermehrt das Wissen um vergangene Krisen die Fähigkeit, mit zukünftigen Bedrohungen umzugehen. Jede Gesellschaft findet eigene Wege im Umgang mit Krisen. Aber zwischen ihren unterschiedlichen Vorgehensweisen gibt es charakteristische Ähnlichkeiten.
Sie haben sich unterschiedliche Krisen angeschaut: Pestausbrüche, Pandemien oder die Asienkrise. Was sind die Gemeinsamkeiten?
Wir sehen Muster, die sich wiederholen: Eine Bedrohung wird benannt, als ein für die Gesellschaft zentrales Thema dargestellt. Wir beobachten in dieser Phase viel Konkurrenz um die Frage: Was genau ist eigentlich das Problem? Das führt zu scharfen Auseinandersetzungen. Dann gibt es eine Art Pingpong zwischen Lösungsvorschlägen, die häufig nicht funktionieren, und schließlich eine neue Definition des Problems. Diesen Prozess durchlaufen Gesellschaften im Verlauf einer Krise mehrmals.
- impulse-Magazin
-
alle
-Inhalte
- digitales Unternehmer-Forum
- exklusive Mitglieder-Events
- und vieles mehr …