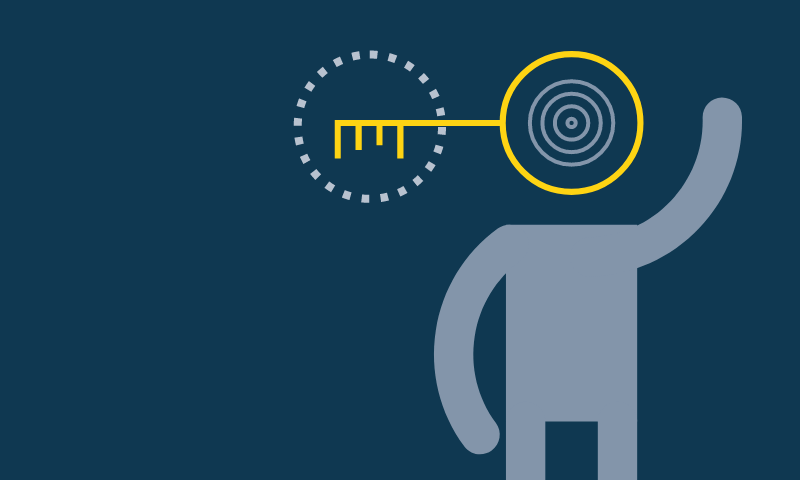Das Chefbüro in der Bonner Werkstatt gleicht einer Bibliothek: Bildbände, Lexika, antiquarische Bücher, an der Wand Skizzen und Fotos, ein paar Orgelpfeifen. Zum Interview hat sich Philipp Klais an den Tisch gesetzt, aber man spürt: Ruhe ist nicht sein Element. Am liebsten ist er unterwegs, in der Werkstatt oder irgendwo auf der Welt, wo gerade eine Orgel entsteht.
impulse: Herr Klais, Sie haben einmal gesagt, Sie hätten kein Alleinstellungsmerkmal.
Philipp Klais: Das ist immer noch so.
Ist das nicht ein Problem?
Es ist ehrlich. Eine Orgel überzeugt durch Individualität, nicht durch Gimmicks. Unser Ansatz ist ja nicht, die eine „perfekte Orgel“ zu entwerfen und in alle Welt zu exportieren, sondern individuelle Instrumente für besondere Räume zu bauen.
Mit diesem Anspruch sind Sie nicht allein. Es gibt über 150 Orgelbauer in Deutschland.
Das sind nur die, die wir als direkte Wettbewerber betrachten. Ich schätze, dass es hierzulande 300 Orgelbauer gibt, viele sind aber sehr klein. International sind es wohl 750 Wettbewerber.
Alle arbeiten nur mit Zinn und Holz und pflegen ein jahrhundertealtes Handwerk.
Ja, jedoch die größere Herausforderung ist, dass wir alle mit großer Leidenschaft bei der Sache sind und glauben, das beste Instrument zu bauen. Was unsere Werkstatt seit über 140 Jahren auszeichnet, ist die immense Planungs- und Fertigungstiefe. Natürlich könnte man zum Beispiel das Tragwerk der Orgel oder das Orgelgehäuse immer extern bauen lassen und diese Bereiche komplett auslagern. Damit würden wir aber Know-how und Kompetenz verlieren. Und das gilt für alle Bereiche in gleichem Maße.
Meine Frage nach dem Alleinstellungsmerkmal haben Sie auf Ihre Instrumente bezogen. Was aber macht Sie als Arbeitgeber besonders?
Das eine lässt sich nicht ganz vom anderen trennen: Wir wollen mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, die eine Leidenschaft für unser Instrument haben, hoch motiviert sind und Freiräume schätzen. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit einem Team arbeiten darf, das meine Ideen teilt. Für mich sind das keine Mitarbeiter, sondern Kolleginnen und Kollegen in unserer Familienwerkstatt.
Und doch stehen Sie im Wettbewerb.
Natürlich gibt es wirtschaftliche Herausforderungen. Es ist ja nicht so, dass wir einen riesigen Kreis von Kunden haben, die nur darauf warten, dass wir ihnen ein Instrument bauen. Orgelbau ist ein Gebiet, das mit so viel Leidenschaft betrieben wird, dass es sehr schwierig ist, auch nur den kühnen Gedanken zu hegen, damit Geld verdienen zu können. Dennoch haben wir klare Ziele und wollen Jahr für Jahr profitabel arbeiten, was uns aber nicht immer gelingt.
- impulse-Magazin
-
alle
-Inhalte
- digitales Unternehmer-Forum
- exklusive Mitglieder-Events
- und vieles mehr …