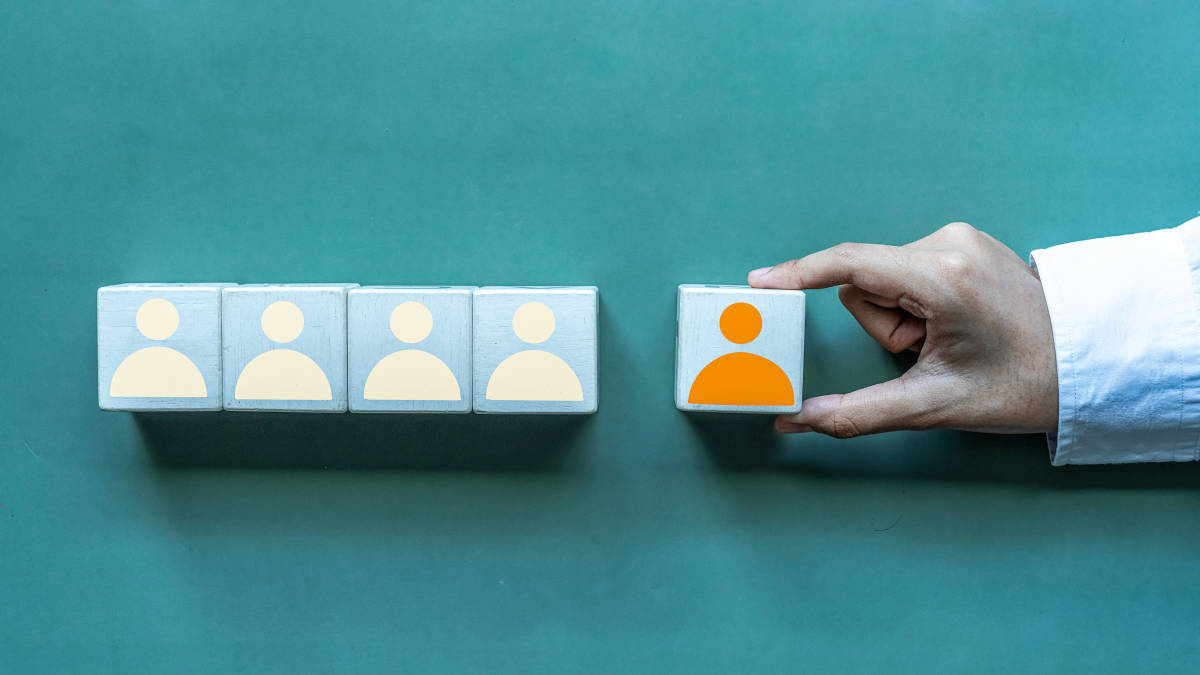impulse: Frau Knipfer, Sie forschen unter anderem zu Teamresilienz. Was ist das?
Kristin Knipfer: Teamresilienz bezeichnet die Fähigkeit von Teams, Stress, Druck und andere Schwierigkeiten zu überwinden, die mit Krisen einhergehen und die Teamleistung oder die Zusammenarbeit beeinträchtigen können.
Was genau macht ein resilientes Team so besonders?
Es findet nach einer Krise nicht nur schnell zum Ausgangszustand zurück, das Team lernt auch aus der Krisensituation, entwickelt sich also durch diese Erfahrung weiter … und ist damit viel besser für zukünftige Krisen gewappnet: Es kann sie eher vorhersehen und mögliche Risiken realistisch einschätzen. Ganz zentral ist: Resiliente Teams gehen mit einer anderen Haltung an Krisen heran als nicht-resiliente Teams.
Was heißt das konkret?
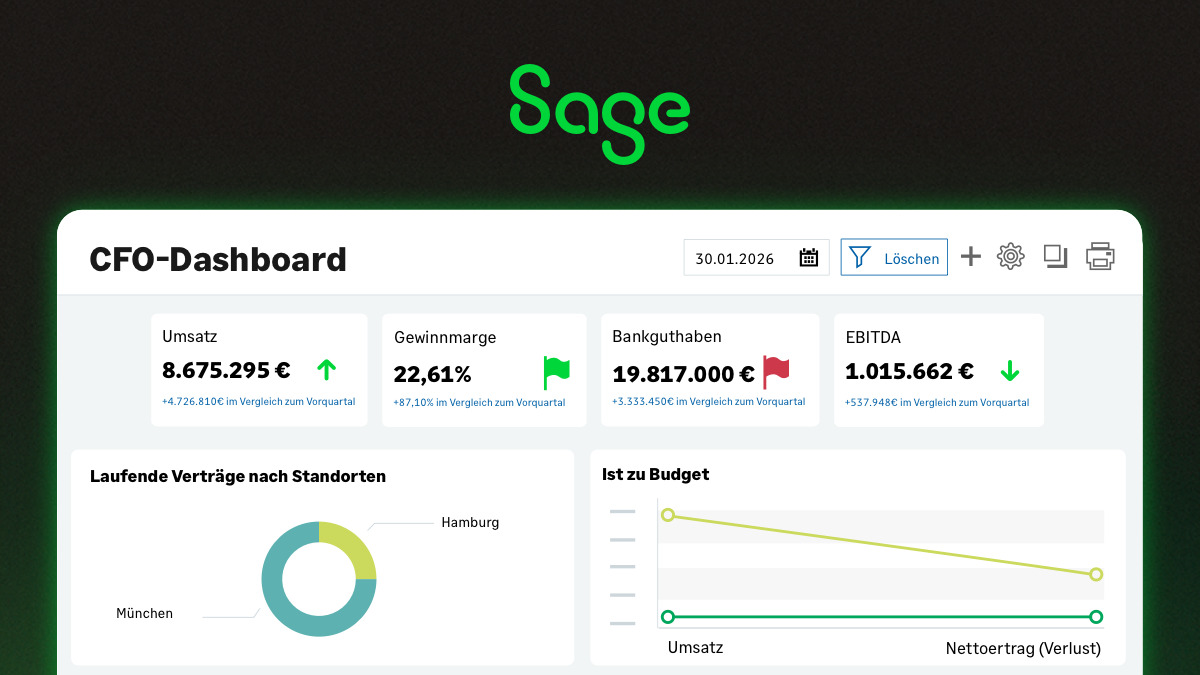
In resilienten Teams herrschen positive Denkmuster vor, wie zum Beispiel: „Wow, das ist echt herausfordernd gerade – aber wir haben schon so viel geschafft, wir können auch damit umgehen.“ Die Teammitglieder sind optimistisch und probieren aktiv Strategien aus, um aktuelle Krisen zu bewältigen. Weil sie schwierige Situationen wie diese Polykrise als Herausforderung ansehen und nicht als Bedrohung.
Und wenig resiliente Teams betonen das Negative?
Genau. Solche Teams haben beispielsweise Angst, alles zu verlieren und sehen allein die Schwierigkeiten, die mit der derzeitigen Lage einhergehen – etwa, dass Prozesse durcheinandergeraten, nichts mehr kontrollierbar scheint und sie keinen Spielraum haben, darauf Einfluss zu nehmen.
 Kristin Knipfer ist promovierte Psychologin, Geschäftsführerin des TUM Institute for LifeLong Learning an der Technischen Universität München und forscht unter anderem zur Frage, wie Führungskräfte Teamarbeit wirksam gestalten können.
Kristin Knipfer ist promovierte Psychologin, Geschäftsführerin des TUM Institute for LifeLong Learning an der Technischen Universität München und forscht unter anderem zur Frage, wie Führungskräfte Teamarbeit wirksam gestalten können.
Wie erkenne ich als Führungskraft, dass in meinem Team die Resilienz nachlässt oder gar nicht da ist?
Warnsignale zeigen sich zum einen im Arbeitsverhalten und zum anderen im Umgang miteinander. Stichwort Arbeitsverhalten: Oft bringen Mitarbeitende weniger Leistung oder aber die Leistung schwankt stark. Meist steigt die Fehlerquote, andere Teammitglieder wirken unkonzentriert oder sind plötzlich unpünktlich.
Und was sind Warnsignale im Umgang miteinander?
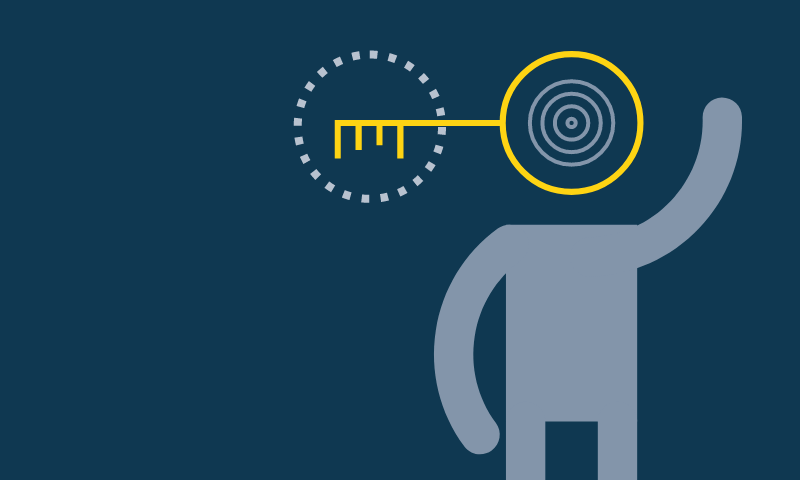
In belasteten Teams ziehen sich häufig einzelne Mitglieder zurück. Sie kommen dann nicht mehr mit zum Mittagessen, gehen in keine Diskussion. Oft ist die Stimmung insgesamt angespannt, schwelende Konflikte kommen hoch. Manchmal wird auch jemand aggressiv und reagiert übersteigert auf kritisches Feedback. Außerdem bestärken sich Teammitglieder in ihrer negativen Wahrnehmung und der gefühlten Hilflosigkeit – das nennen wir in der Forschung kollektive Rumination.
Kollektive Rumination?
Rumination ist ein typisches Symptom einer Depression: Betroffene grübeln, fragen sich, warum diese Probleme ausgerechnet sie treffen und spekulieren über alle möglichen negativen Auswirkungen, die die Situation haben wird.
Das Gleiche geschieht auch in wenig resilienten Teams: In Meetings oder beim Gespräch an der Kaffeemaschine stecken sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann gegenseitig mit ihrer negativen Einschätzung an. Alles dreht sich nur noch um Krisen und Probleme, Konstruktives hat keinen Platz mehr.
Aber ist es nicht normal, in einer Krise über Negatives zu reden?
Natürlich. Und kurzfristig kann es auch erleichternd wirken, denn es zeigt: Hey, wir sitzen im gleichen Boot, den anderen geht es ganz genauso wie mir. Aber danach geht es allen meist schlechter. Jedenfalls dann, wenn nicht auch mögliche Lösungen für eine belastende Situation besprochen werden.
So eine Jammerspirale kann ein Team komplett vereinnahmen: Sie raubt zeitliche und emotionale Ressourcen, die eigentlich nötig wären, um an einer Lösung zu arbeiten.

Wie merke ich denn, ob es nur einem Mitarbeiter schlecht geht – oder ob mein Team insgesamt erschöpft ist?
Diese Frage führt auf einen falschen Pfad. Oft genügt schon eine Person, die ihre negativen Gefühle ausdrückt, um das ganze Team zu beeinflussen. Das läuft auch über Gestik und Mimik: Jemand schaut grimmig, verschränkt die Arme, runzelt permanent die Stirn. Hinzu kommt, dass wir uns eher denjenigen mitteilen, die ähnlich denken und auch Verständnis für uns zeigen, weil sie uns bestätigen. So steckt ein Teammitglied schnell zwei, drei andere im Team an. Hier müssen Führungskräfte direkt reagieren und dürfen nicht denken: „Wenn nur einer schlecht drauf ist, wird’s so schlimm nicht sein.“
Wie kann ich mein Team in der Krise stärken?
Für viele Führungskräfte ist der erste Schritt, überhaupt anzuerkennen, dass sie hier zuständig sind und auch Fürsorgepflichten haben. Führungskräfte fühlen sich immer noch vor allem für die Leistung zuständig. Und sind – aus dieser aufgabenorientierten Perspektive heraus – dann eher verärgert, wenn Teammitglieder in Krisenzeiten nicht die gleiche Leistung bringen wie sonst. Wer denkt wie: „Die sollen sich jetzt mal zusammenreißen“, wird die Symptome belasteter Teams nicht bemerken.
Was hilft denn, die Symptome zu erkennen?
Eines meiner Lieblingstools sind die „Fünf-Minuten-Gespräche“: Führungskräfte sollten mindestens fünf Minuten pro Woche mit jedem Teammitglied reden. So bekommen sie mit, wie es allen geht, was Einzelne und das Team insgesamt beschäftigt. Außerdem bauen die regelmäßigen Gespräche für Mitarbeitende Hürden ab, sich der Führungskraft mitzuteilen.
Und wenn ich merke, viele sind belastet – wie erhöhe ich die Teamresilienz?
Da haben Sie zwei Ansatzpunkte: Reduzieren Sie einerseits Belastungen und stärken Sie andererseits die Ressourcen ihrer Teammitglieder.
Was heißt das konkret?
Sie könnten flexiblere Arbeitszeiten einführen, damit Ihre Mitarbeitenden dann arbeiten können, wenn es für sie gut passt. Sorgen Sie für eine Arbeitsumgebung ohne belastende Faktoren: mit moderner Ausstattung, nicht zu warm, nicht zu kalt, kein Lärm. Versuchen Sie außerdem, die Aufgabenorganisation zu verändern, um mehr Handlungsspielraum zu geben. Dabei helfen Fragen wie: Wie viel Freiheit kann ich Herrn oder Frau XY geben, um die Aufgaben zu erledigen?
Und nicht zu vergessen: Schaffen Sie Redundanzen!
Wie meinen Sie das?
Wichtige Aufgaben und Tätigkeiten könnten immer mehrere aus einem Team beherrschen. So kann man leichter füreinander einspringen und sich gegenseitig unterstützen.
Was bringt das?
Wir Menschen haben ein Grundbedürfnis nach Autonomie und danach, uns als kompetent zu erleben. Teammitgliedern mehr Freiheit zu geben und sie den Arbeitsalltag mehr selbst strukturieren zu lassen, erfüllt dieses Grundbedürfnis.
Dazu stärkt es die Selbstwirksamkeit, also das Vertrauen, durch eigene Fähigkeiten und Ressourcen eine Aufgabe bewältigen zu können. Und mehr Selbstwirksamkeit wiederum sorgt dafür, dass wir ein Gefühl von Kontrolle bekommen – gerade in Krisensituationen ist das extrem wichtig.
Was hilft erschöpften Teams noch?
Das Gefühl, Einfluss auf die Situation nehmen zu können. Deshalb sollten Führungskräfte Verantwortung teilen und Partizipation erlauben. Oft bringt es schon etwas, einfach mal zu fragen: „Was empfindet ihr gerade als besonders herausfordernd? Was würde euch konkret entlasten? Was können wir gemeinsam tun, um es uns als Team leichter zu machen?“
Und mit welchen Fehlern schwächen Führungskräfte umgekehrt die Teamresilienz?
Etwa mit gut gemeinten Ratschläge, wie etwa: „Ach, schlafen Sie sich einfach mal richtig aus“ oder „Morgen wird ein besserer Tag“. Auch übermäßig optimistisch über die kritische Lage und die Belastung zu sprechen, schadet. Etwa so: „Kommt, wir reißen uns jetzt alle mal zusammen, so was hat noch niemandem umgebracht.“ Ein weiterer Fehler: von oben herab allein entscheiden, ohne eine Beteiligung zu ermöglichen.
All das setzt Teams unter Stress und schürt vorhandene Ängste und Unsicherheiten.
Die aktuellen Krisen belasten ja auch die Führungskräfte selbst. Inwieweit sollten sie das vor dem Team ansprechen?
Eine hochemotionale Ansprache zu halten und vielleicht sogar zu weinen, wäre keine gute Idee, das würde die Mitarbeitenden wahrscheinlich verunsichern. Aber mal etwas zu sagen wie: „Die Situation ist auch für mich belastend“, ist angemessen. Wichtig ist, die eigenen Emotionen und die eigene Belastung achtsam wahrzunehmen und dann wieder einen Schritt zurück zu machen, damit gut umzugehen und auch darüber zu sprechen. Sie sind hier auch Vorbild für Ihr Team.
Wie schaffe ich das?
Sie könnten beispielsweise erklären, wie Sie selbst mit der Belastungssituation umgehen, wo Sie sich Unterstützung holen. Etwa, dass Sie viel mit Freunden und Kollegen sprechen. Das ermutigt Ihr Team zum einen, sich auch auszutauschen. Zum anderen zeigen Sie: Meine Tür steht für euch offen! Und schließlich: Sie sind damit authentisch – und das zeichnet gute Führungskräfte aus.
Haben Sie noch einen letzten konkreten Tipp?
Es kann auch helfen, in einem Meeting anzubieten: „So, jetzt lassen wir mal zehn Minuten alles raus, was uns ärgert oder belastet.“ Ist die Zeit um, muss die Führungskraft die Stopp-Taste drücken, um auch die konstruktive Seite zu betrachten und mit dem Team zu überlegen: Was machen wir denn jetzt mit den starken Emotionen? Wo können wir Einfluss nehmen, um die Situation zum Positiven zu ändern?
Genau darum dreht es sich in einer Krise immer wieder: Gefühlen Raum geben, dann ins Reflektieren kommen – und versuchen, etwas zu ändern. Wenn Teams das verinnerlichen, ist eine gute Basis für Resilienz gelegt.