Inhalt: Darum geht's in diesem Beitrag
Ob als Anbieter von Onlinekursen, als Softwarehersteller oder Gründer eines Datingportals – wer auf seiner Website Produkte oder Services verkauft, braucht ein Preismodell. Wie ein solches aussehen kann, zeigt die folgende Übersicht zu vier verschiedenen Preismodellen – samt Angaben zur Frage, welche Chancen und Risiken mit ihnen einhergehen und für welche Firmen sie geeignet sind.
Preismodell „Free“
Bei diesem Modell können Kunden die Inhalte einer Website kostenlos nutzen. Das ist beispielsweise häufig bei Online-Zeitungen, -Magazinen oder Blogs der Fall. Firmen, die das Free-Preismodell nutzen, finanzieren den Betrieb über Werbeanzeigen. Dabei gilt: Je mehr Internetnutzer auf eine Seite klicken, desto höhere Werbe-Einnahmen sind möglich.
Vor- und Nachteile des Free-Modells
Wenn täglich tausende Besucher auf die Seite klicken, kommt entsprechend viel Geld in die Kasse. Bleiben dagegen die Besucher aus, fehlen auch die Einnahmen.
Ein weiterer Nachteil: Immer mehr Internetuser nutzen Ad-Blocker, die Werbung ausblenden – das senkt die Reichweite und damit die Einnahmen.
Für wen das Modell geeignet ist
„Das Free-Modell ergibt nur Sinn, wenn man eine große Reichweite hat“, sagt Georg Tacke, Pricing-Spezialist und CEO der Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners. „Und die haben nur ganz wenige Website-Betreiber.“
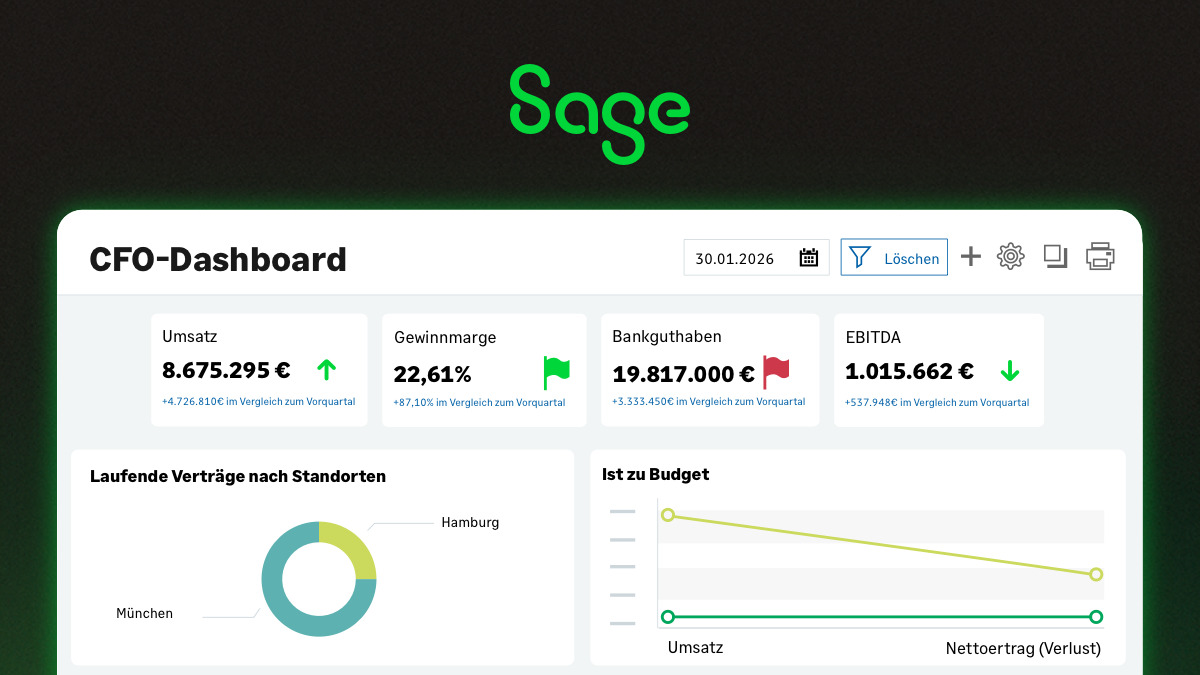
Ausnahme: Wer stark spezialisiert ist und innerhalb seiner Zielgruppe eine hohe Reichweite aufweist, könnte trotz vergleichsweise geringer Nutzerzahlen vom Free-Modell profitieren: Eine Bloggerin etwa, die über nachhaltige Mode für Schwangere und Mütter schreibt, kann Werbetreibende überzeugen, die auf Mütter zugeschnittene Anzeigen schalten wollen. „Je pointierter ich bin, desto besser“, sagt Tacke.
Interessant ist das Free-Modell zudem für viele Firmen als Einstiegs-Variante: Kunden können das Angebot kennenlernen, ohne dass ihnen Kosten entstehen. Wollen sie dann bestimmte Zusatzleistungen nutzen und dafür bezahlen, wird aus dem Free-Preismodell das Freemium-Modell.
Preismodell „Freemium“
Freemium ist ein so genannten Kofferwort, eine Mischung aus den Wörtern „Free“ und „Premium“: Firmen bieten sowohl kostenlose Inhalte und Leistungen an als auch kostenpflichtige Zusatzangebote. Der Musik-Streamingdienst Spotify nutzt dieses Modell beispielsweise, genau wie der Cloudspeicher Dropbox, das Datingportal Parship oder die Karrierenetzwerke Xing und LinkedIn.
Die kostenlosen Angebote dieser Firmen sind immer eingeschränkt: Spotify etwa bietet zwar Millionen von Songs und Hörbüchern gratis an, die Nutzer müssen dafür im Gegenzug in der kostenlosen Version Werbung ertragen. In der Premiumversion entfällt die Werbung, man kann auch offline Musik hören und die Tonqualität ist besser.
Bei Parship können sich Singles auf Partnersuche zwar durch die Profile anderer Nutzer klicken, aber keinen Kontakt zu ihnen aufnehmen – geschweige denn eingegangene Nachrichten lesen. Wer mit anderen Singles schreiben will, muss einen festen monatlichen Beitrag zahlen.
Vor- und Nachteile des Freemium-Modells
Das Freemium-Modell ist weit verbreitet. Kostenlose Einstiegsangebote ermöglichen Firmen, einen breiten Kundenstamm aufzubauen. Das Risiko: Viele Kunden sind womöglich nicht zahlungsbereit.
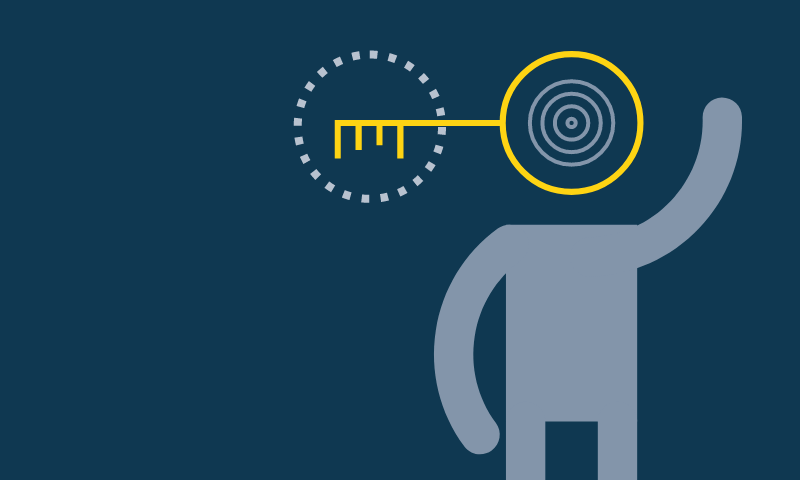
„Bei Freemium gilt das Prinzip „land and expand“: Erst beim Kunden landen, dann expandieren“, erklärt Pricing-Experte Tacke. „Die meisten Unternehmen versäumen es aber, zu expandieren, also kostenpflichtige Premiumangebote zu schaffen. Wir empfehlen unseren Kunden daher, von vornherein zu überlegen, wie ein erfolgreiches Premium-Modell aussehen könnte.“
Für wen das Modell geeignet ist
Freemium ist weit verbreitet und eignet sich für viele digitale Geschäftsmodelle – Hauptsache, so Tacke, man packt nicht zu viele Features in das kostenlose Angebot. Denn sonst nutzen es zwar viele, aber keiner zahlt dafür.
Preismodell „Pay what you want“
2007 veröffentlichte die britische Band Radiohead ihr Album „In Rainbows“ – die Besonderheit: Fans konnten zwei Monate lang selbst entscheiden, ob und wie viel sie für das Album zahlen wollten. Letztlich luden rund drei Millionen Menschen das Album runter, 62 Prozent von ihnen zahlten nichts.
Für Radiohead lohnte sich die Aktion dem US-Magazin Medium zufolge zwar, weil sie keine Abgaben an ein Label zahlen musste – sie machten aber auch nur minimal mehr Gewinn als mit gewöhnlichen Verkäufen und wiederholten die Aktion nie wieder.
Vor- und Nachteile des Pay-what-you-want-Modells
Das Risiko dieser Strategie liegt auf der Hand: Wenn Kunden nicht zahlen müssen, tun es viele auch nicht – im schlimmsten Fall bleibt man auf den eigenen Kosten sitzen.
Andererseits: „Wenn bei der eigenen Zielgruppe aber Fairness, Moral, Wertigkeit und Gegenwert eine wichtige Rolle spielen, lassen sich mitunter auch gute Preise erzielen“, sagt Tacke.
Für wen das Modell geeignet ist
Georg Tacke rät grundsätzlich vom Pay-what-you-want-Modell ab. Es sei zwar immer wieder im Trend, lohne sich letztlich aber nicht. „Ich kenne kein Beispiel, bei dem es in großem Stil erfolgreich angewandt wurde.“

Website-Betreiber könnten es höchstens für einmalige Aktionen ausprobieren oder damit testen, wie viel Nutzer für ein Premium-Produkt zu zahlen bereit sind.
Preismodell „Subscription“
Wer früher Programme wie Photoshop vom Softwareunternehmen Adobe kaufen wollte, musste mehrere hundert Euro dafür hinlegen. Dann schwenkte das Unternehmen auf ein Subscription-Modell um: Wer das Bildbearbeitungsprogramm Photoshop heute nutzen möchte, muss ein Jahresabo abschließen – oder aber das Programm monatsweise buchen.
Auch Online-Zeitungen, Fitness-Apps und Video-Streaming-Anbieter wie Netflix nutzen dieses Preismodell – und inzwischen sogar Anbieter physischer Produkte, wie der Dollar Shave Club in den USA, der Kunden für einen Abopreis alle vier Wochen neue Rasierklingen und Pflegeprodukte schickt.
Ähnlich wie beim Freemium-Modell können Nutzer die meisten Angebote für einen kurzen Zeitraum kostenlos oder vergünstigt testen. Freemium und Subscription sind daher nicht immer klar voneinander abzugrenzen – denn letztlich ist auch die monatliche Zahlung bei Spotify oder Parship ein Abo.
Vor- und Nachteile des Subscription-Modells
Das Subscription-Modell hat sich in den vergangenen Jahren in vielen Online-Geschäften etabliert und ist laut Tacke sehr wichtig geworden. „Kunden sind durchaus bereit, sich durch eine Subscription an ein Unternehmen zu binden“, sagt Tacke.
Dafür aber müssen Firmen ihren Abonnenten, oder auch Subscriber, bei Laune halten: Wer für einen monatlichen Fixpreis Insider-Neuigkeiten aus der Finanzbranche verkauft, verprellt Kunden, wenn er nur alle paar Wochen etwas veröffentlicht. Softwareanbieter müssen ihre Produkte regelmäßig aktualisieren, damit Kunden nicht zur Konkurrenz abwandern.
Ein weiterer Nachteil: Es gibt mittlerweile so viele Abo-, beziehungsweise Subscription-Angebote, dass einige Menschen davor zurückschrecken, ein weiteres abzuschließen. „Subscription Fatigue“ nennen Experten dieses Phänomen, also Abo-Müdigkeit.
Für wen das Modell geeignet ist
Das Subscription-Modell eignet sich für alle, die Produkte oder Services anbieten, die Kunden sehr oft und regelmäßig nutzen. Alle anderen haben mit diesem Modell keine Chance auf Einnahmen. Denn: Wer nur alle paar Monate mit dem Fernbus in eine andere Stadt fährt, wird deshalb kaum ein Bus-Abo abschließen.
Wie Sie einen Preis für Ihr Produkt finden, der konkurrenzfähig ist und Kunden lockt, lesen Sie in unserem Artikel zur Preiskalkulation.
 Georg Tacke ist Pricing-Spezialist und CEO der Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners. 2016 veröffentlichte er das Fachbuch „Monetizing Innovation: How Smart Companies Design the Product Around the Price“.
Georg Tacke ist Pricing-Spezialist und CEO der Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners. 2016 veröffentlichte er das Fachbuch „Monetizing Innovation: How Smart Companies Design the Product Around the Price“. 




