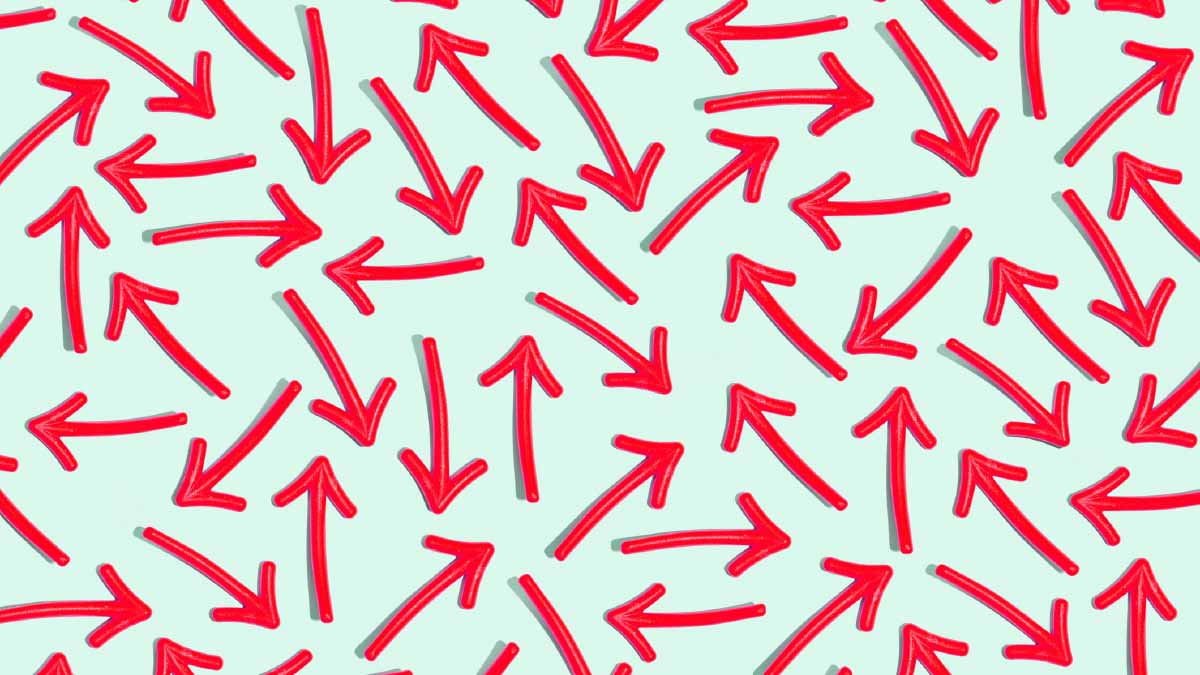Weißer Anzug, weißes Hemd, weiße Schuhe. Selbst der Gürtel ist weiß. Keine Frage, Jürgen Schmid sieht aus wie ein Popstar. Wenn der Maschinendesigner seinen Kunden, den Maschinenbauern, ein Produkt entworfen hat, verdient er daran auch nach dem Prinzip Popstar: Mit jeder verkauften Maschine gibt es mehr. Wie bei einem Sommerhit, der viele Sommer später noch Geld einbringt, weil er gespielt, gekauft, gecovert wird.
Schmid gehört das Industriebüro Design Tech. Die Neun-Frauen-und-ein-Mann-Firma in Ammerbuch nordwestlich von Tübingen entwirft für Kunden in ganz Europa, in den USA und Asien. Schmid, seit fast 30 Jahren im Geschäft, hat sich ein Honorarmodell ausgedacht, das es so noch nicht gegeben hat im Maschinenbau. Anstatt einen festen Preis für einen Auftrag zu verlangen, fordert er eine Beteiligung am Umsatz, den sein Auftraggeber mit der Maschine macht, die Schmid für ihn entwirft.
Klingt erst einmal verrückt, ist gerade in der Krise aber clever: Weil die Anfangskosten niedrig ausfallen, nutzen Hersteller das Ansinnen als Chance. Hans-Joachim Bender, Geschäftsführer des Anlagenbauers Bürkle: „Wenn man pauschal bezahlt, steht meist eine Riesensumme im Raum. Die Erfolgsbeteiligung schont unsere Liquidität und nimmt den Designer mit ins Risiko.“
Das Prozentesystem ändert das Herangehen an das Maschinendesign. Da zähle sowieso nicht Schönheit, sondern Nutzwert, geringerer Materialverbrauch, Sparsamkeit, Bedienkomfort und Sicherheit, sagt Schmid. Und genau darauf würden seine Designer jetzt noch aufmerksamer achten: Funktionalität ist alles, künstlerische Eitelkeiten spielen keine Rolle mehr. Es geht dem Mann mit dem Weißfimmel und seinen Mitarbeitern um Verkaufsförderung. Auch wenn die Designer zuvor in Vorleistung treten müssen.
Für den Holzmaschinenspezialisten Bürkle hat Design Tech die Walzenauftragmaschine Easy Coater für Solarzellen entwickelt. Damit wagen die Schwarzwälder den Eintritt in den Fotovoltaikmarkt. Das Beteiligungsmodell war die Voraussetzung, sagt Geschäftsführer Bender, um diesen Schritt überhaupt unternehmen zu können.
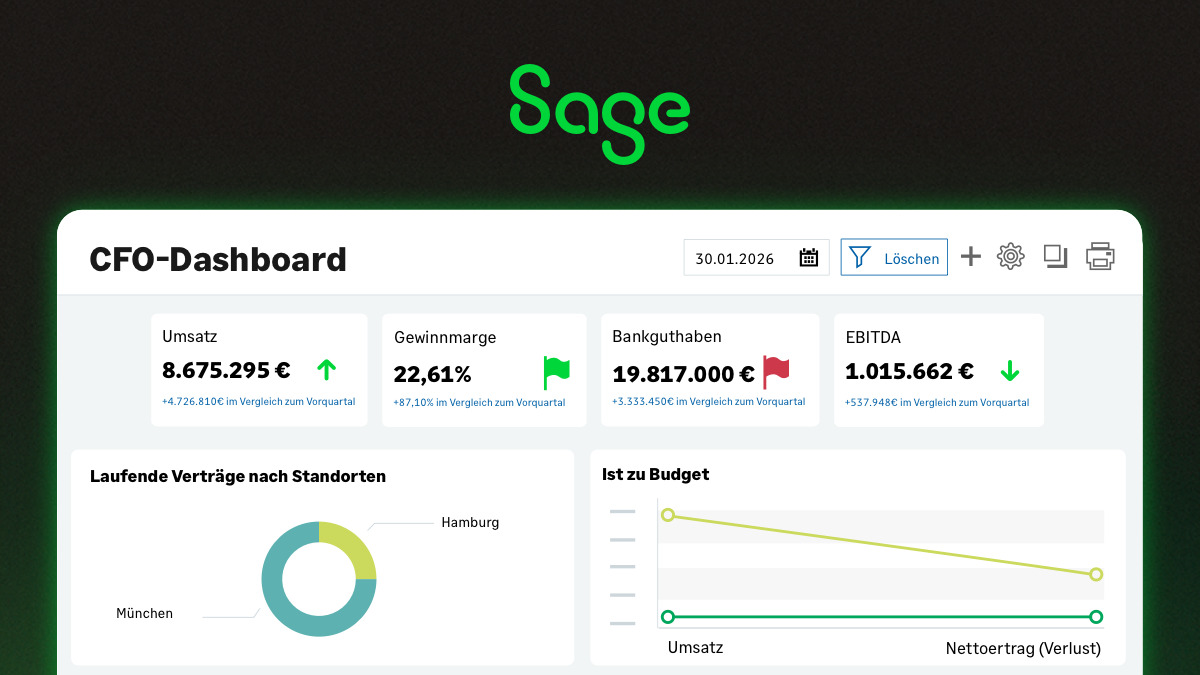
Der Easy Coater ist mittlerweile seit drei Jahren auf dem Markt, und Schmid kassiert Tantiemen: Die Verträge laufen „so lange, wie das Unternehmen unser Design verwendet“. Weil die Designer ständig optimieren, könnte das länger der Fall sein als die üblichen sieben bis zehn Jahre.
Je länger seine Maschinen produziert werden, desto lohnender wird der Deal für Schmid. Den Easy Coater verkauft Bürkle rund 120-mal pro Jahr, das Stück für 35.000 Euro. Design Tech hat außerdem noch ein Laminiergerät für Bürkle entworfen, den Ypsator. Der kostet satte 1,5 Millionen Euro; in zwei Jahren hat Bürkle 25 davon verkauft. Und Schmid kriegt Prozente.
Das Grundprinzip
Wie viele? Das bleibt geheim. Einen Richtwert verrät Schmid dann doch: Bei manchen Aufträgen kassiert er 15 Prozent des Umsatzes. Aber das lasse sich nicht verallgemeinern, mit seinen Kunden strickt Schmid für jeden Auftrag ein Spezialmodell.
Nur das Grundprinzip ist immer gleich: Als Garantie, dass ein Entwurf in Produktion gehen wird, zahlt der Neukunde ein Basishonorar. Mal 5000 Euro, mal 50.000. Bei Folgeverträgen fällt kein Basishonorar mehr an. Sobald Maschine oder Bauteil auf dem Markt sind, beteiligt er den Designer je nach Stückzahl und Herstellungskosten am Umsatz. Je niedriger das Grundhonorar, desto höher sein Anteil am Erfolg.
Bevor die Verträge unterschrieben werden, müssen beide Seiten daher prüfen, wie weit sie ins Risiko gehen wollen. Wird die Maschine kommerziell ein Erfolg, sind beide zufrieden. Bürkle-Chef Bender hat kein Problem damit, dass er für seine Laminiergeräte mehr zahlen wird als bei einem Festhonorar: „Eine saubere Gewinnverteilung“ sei das. Er hat inzwischen weitere Prozenteverträge mit Design Tech geschlossen.
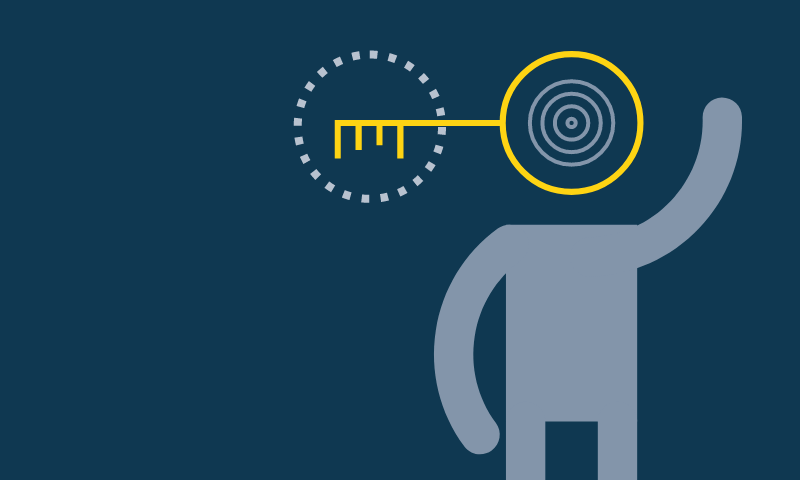
Seinen entscheidenden Kundenvorteil sieht Bender in der gegenseitigen Abhängigkeit. Sobald das Produkt sich schlechter verkauft, bringt es weniger ein. Also gibt es Druck, ständig zu verbessern, auch für den Designer. „Weil er am Erfolg beteiligt ist, bringt er kontinuierlich Ideen ein und modifiziert die Anlage“, sagt Bender. Früher hätten sich Schmid und seine Leute verabschiedet, sobald die Maschine auf dem Markt war. Heute erkundigen sie sich nach Verkaufszahlen, machen Verbesserungsvorschläge, hängen sich mehr rein.
| Spart Steuern |
|---|
| Ob sie alles auf einen Schlag bekommen oder über Jahre verteilt in Häppchen, darüber sollten Unternehmer mit ihrem Steuerberater sprechen. Denn: Wer nicht alles auf einmal versteuert, sondern über Jahre verteilt, kann Steuern sparen. Das funktioniert aber nicht immer. Wer Pech hat, zahlt sogar drauf. Wolfgang Bornheim vom Bundesverband der Steuerberater: „Pauschal lässt sich nicht sagen, ob Erfolgshonorare Steuern sparen.“ Eine Steuerberater-Faustregel besagt: Bei stark schwankenden Einnahmen – Erfolgsbeteiligungen können genau dazu führen – zahlt man eher mehr ans Finanzamt. Es kann aber rein rechnerisch auch das Gegenteil eintreten, wenn es nur zu wenigen Spitzen bei den Einnahmen kommt. |
| Da geht schon was „Eine Umsatzkomponente kann progressionsmildernd wirken, da sie sich leichter steuern lässt als Fixhonorare“, erklärt Bornheim einen Steuerspareffekt. Außerdem: „Eine GmbH zahlt mit dem Erfolgshonorarmodell dauerhaft weniger Steuern, solange der Inhaber den Gewinn nicht an sich ausschüttet.“ Fazit: Da geht was, aber nur auf komplizierten Wegen. Die große Ausnahme: Für Unternehmer, die sowieso den Spitzensteuersatz zahlen, ändert ein erfolgsabhängiges Honorar nichts. |
Wenn in den alten Zeiten ein Holzmaschinenhersteller 300 Arbeitsstunden bezahlte, um von Design Tech neue Bedienelemente für eine Industriesäge entwerfen zu lassen, arbeitete Schmids Team früher den Auftrag in 300 Stunden ab. Keine weniger, keine mehr. „Die Fixdauer engt unsere Kreativität ein“, regte sich der Chef auf. Immer wieder müsste sein Büro Standardlösungen liefern, anstatt sein Potenzial nutzen zu können.
Irritierte Kunden wollen mehr zahlen
Der Gedanke, wie er aus der Falle herauskommen könnte, kam Schmid nach seinem größten Treffer: Für einen Elektrohersteller hatte er einen kleinformatigen Akkuschrauber entworfen. Leider noch zu Honorarzeiten. Statt der erwarteten 20.000 Schrauber im ersten Jahr verkaufte der Hersteller auf Anhieb 150.000. Schön für den Hersteller, aber Schmids Honorar blieb gleich. „Wir hatten den Einfall, und der Kunden verdiente. Da habe ich gesagt, wir machen jetzt ein Modell, bei dem wir vom Erfolg unserer Produkte profitieren.“
2007 schloss Schmid den ersten Vertrag auf Beteiligungsbasis, heute sind es 20, also ungefähr jeder vierte. Aber der Anfang war schwer. Erfolgsbeteiligung? Die Kunden waren irritiert. „Was soll das?, fragten viele, wir zahlen doch alles sofort, könnten sogar was drauflegen.“ Schmid gab nicht nach: „Ich wollte ein System schaffen, das motiviert“, sagt er. Inzwischen hat er einige seiner Kunden überzeugt. Zum Beispiel bezahlt der Spezialleuchtenhersteller Waldmann ihn pro verkaufte Leuchte. „Es entspricht der Philosophie unseres Hauses, wonach sich Erfolg für beide Seiten lohnen soll“, heißt es bei Waldmann. Auch Carl Stahl, ein Hebetechnikbauer, nutzt die Idee. „Ein faires Modell, das Hersteller wie Designer motiviert“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Schwenger.
Anlaufzeit bis zu sieben Jahre
Auf den Umsatz von Design Tech hat sich das neue Geschäftsmodell noch nicht ausgewirkt. Etwa vier bis sieben Jahre, überschlägt Schmid, werde es dauern, bis die Anteile am Erlös das Festhonorar überholen. Seinen Mitarbeitern wird die Zeit nicht lang: „Der offenere Zeitplan ist ein Pluspunkt“, sagt Designerin Anna Zesewitz. „Wir können uns intensiver um Chancen und Knackpunkte eines Modells kümmern, die oft erst im Verlauf der Arbeit auftauchen.“

Mehrere Tausend Arbeitsstunden im Jahr finanziert Schmid derzeit vor, mit dem Honorarsystem brauchen seine Projekte zehn- bis 30-mal so viel Zeit. Das Risiko gehe er bewusst ein, sagt der Geschäftsmann Schmid, weil er die Chance erhalte, später deutlich mehr zu verdienen. Geld sei ohnehin nicht entscheidend gewesen für sein neues Konzept. Wichtiger war ihm, dass er sich nun Gedanken über das ganze Produkt machen könne.
Der Designer mag es konzeptionell. Deshalb auch der weiße Auftritt: „Bei einem Designer gehen alle davon aus, dass er ganz in Schwarz daherkommt.“ Schmid zieht am Zigarillo. Lächelt. „Ich trage Weiß.“
Das Weiß sei ein Zufall gewesen, sagt Schmid, entstanden bei einem Fototermin. Es sollte ein Symbol sein für Coolness plus Selbstironie. Der Exoteneffekt gefiel Schmid, er machte es zu seinem Markenzeichen.
Erst auffallen, anders sein und anschließend das positive Vorurteil durch gute Arbeit bestätigen. Inwiefern das auffällige Anderssein beim Verknüpfen von Honorar und Erfolg eine Rolle spiele? Schmid lächelt: weiß wie die Unschuld.
| Wer hat’s erfunden? |
|---|
| Der Maschinendesigner Jürgen Schmid ist einer der wenigen, die auf Prozentebasis arbeiten – der Erste aber ist er nicht. Gestalter für Möbel- und Lampenfirmen lassen sich schon lange auf Erfolgsbasis honorieren. |
| Badmöbelmacher Das Prinzip des „Profit für Profit“ kommt wohl aus der Möbelbranche. Das Büro Sieger Design, das Badmöbel für Duravit und Dornbracht gestaltet, lässt sich seit mehr als 30 Jahren Erfolgsbeteiligungen von den Herstellern zahlen, zwischen ein und zehn Prozent des Umsatzes, sagt Geschäftsführer Christian Sieger. „Wir sind am Erfolg beteiligt, tragen aber auch Risiko mit.“ Das System sei eine treibende Kraft: „Würden wir mit dem klassischen Bezahlmodell arbeiten, könnte uns der Erfolg eines Produkts egal sein.“ So sei die Motivation höher. Alles drehe sich ums bessere Verkaufen. „Das geht so weit, dass ich mir in Hotels immer genau das Bad anschaue, den Hotelier auf Schwachstellen hinweise, dann meinem Kunden sage, wo sich ein Angebot lohnt.“ |
| Hier ging das Licht an Vor den Möbelmachern war das Licht. Thomas Happel vom Lampenproduzenten Ingo Maurer in München sagt: „Wir bezahlen externe Designer seit den 70er-Jahren mit Lizenzen und beteiligen sie prozentual am Jahresumsatz, den wir mit von ihnen entwickelten Leuchten erzielen.“ Die Idee hatte der Chef. Ingo Maurer hatte bis dahin alle Lampen selbst gestaltet. Als er auch Kollegen-Entwürfe produzieren ließ, führte er das Bezahlsystem ein, um die Anfangskosten so gering wie möglich zu halten. |