impulse: Herr Rose, stellen Sie Leute ein, die AfD wählen?
Alexander Rose: Natürlich.
Ich frage wegen Ihres politischen Engagements. Bei Demos gegen Rechts funktionieren Sie Ihre Lkw zu Bühnen um, Sie fahren beim CSD mit.
Ja, aber Sie werden bei mir keine Plakate gegen die AfD sehen oder ein Schild mit der Aufschrift „Nazis raus“. Das ist nicht meine Sprache. Ich will niemanden ausschließen.
Wie setzt sich Ihre Belegschaft zusammen?
Wir haben seit vielen Jahren Menschen mit ausländischen Wurzeln. Wir haben gebürtige Sachsen mit roten oder grünen Parteibüchern. Und wir haben die Beschäftigten, die AfD wählen. Manche Mitarbeiter hängen sich einen Dynamo-Dresden-Schal ins Fahrerhaus ihres Lkw. Das finde ich in Ordnung, auch wenn viele Fans als rechts gelten.
In anderen Speditionen in Sachsen klebt in altdeutscher Schrift an der Scheibe das Wort „Führerhaus“. So etwas erlaube ich nicht.
Schaffen Sie es, die Politik aus dem Betrieb herauszuhalten?
Mein politisches Engagement soll im Betriebsalltag keine Rolle spielen. Neulich sagte ein Mitarbeiter: „Herr Rose, was Sie machen, tut unserer Firma nicht gut. Ich musste mir montagsmorgens an der Laderampe beim Kunden anhören, wo unsere Lkw am Wochenende wieder waren.“ Sowas nehme ich sehr ernst, denn mein Engagement darf nicht geschäftsschädigend werden.
 Alexander Rose leitet den Speditionsbetrieb Radensleben-Transporte in Dresden. Mit seinen Lkw fährt er auf Demokratie-Demos und zum Christopher Street Day. Während einige seiner Mitarbeiter mit dem Aktivismus nichts anfangen können, engagieren sich andere mit ihm.
Alexander Rose leitet den Speditionsbetrieb Radensleben-Transporte in Dresden. Mit seinen Lkw fährt er auf Demokratie-Demos und zum Christopher Street Day. Während einige seiner Mitarbeiter mit dem Aktivismus nichts anfangen können, engagieren sich andere mit ihm.
Wo waren Sie da?
Damals war ich bei mehreren Demonstrationen für die Brandmauer.
Da würden Sie nun nicht mehr hingehen?
Doch.
Wo verläuft die Grenze?
Von linksradikalen Demonstrationen halte ich mich fern. Gewalt lehne ich ab.
Sprechen Sie im Betrieb über Politik?
Als Chef sage ich zu meinen Mitarbeitern, sie sollen wählen gehen. Was sie wählen, das müssen sie selbst wissen. Ich werde um Gottes Willen nie sagen, was richtig und was falsch ist. Ich will nicht belehren. In einer Spedition muss man nicht über Politik reden. Beim Mittagessen geht es um den Garten oder den Campingausflug am Wochenende. Natürlich darf jeder diskutieren, solange es sachlich zugeht, das begrüße ich sogar. Was nicht geht, ist Diskriminierung jeglicher Art, da schreite ich ein.
Kommt das oft vor?
Selten. Es gab mal einen Mitarbeiter, der hat in der Chat-Gruppe der Firma sexistische Sprüche geschrieben. Die habe ich gelöscht und darauf hingewiesen, dass solche Dinge hier nicht hingehören. Später bat ich ihn nochmal zum Gespräch, da entgegnete er sofort: ‚Passiert nie wieder‘. Meine Fahrer wissen schon von sich aus, was geht und was nicht. Wir achten von Anfang an darauf, dass hier niemand reinkommt, der spaltet.
Wie?
Wenn jemand zum Bewerbungsgespräch auftaucht mit einem Thor-Steinar-Pulli – ein rechtes Symbol –, dann unterbreche ich und kläre über unsere politische Haltung auf, darüber, dass es Ausgrenzung in dieser Firma nicht gibt. Ich sage dann, er soll in drei Tagen wiederkommen – mit einem anderen Pulli.
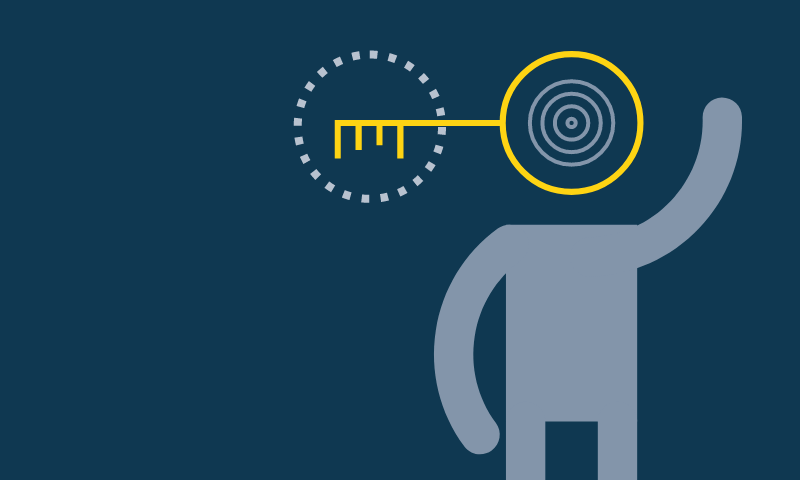
Können Sie es sich leisten, auf Bewerbungen zu verzichten?
Natürlich haben wir Arbeitskräftemangel, aber nicht so stark wie andere Unternehmen. Wir bekommen die Leute, denen es in anderen Betrieben wegen ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft nicht gut ging. Die kommen zu uns und können wieder atmen.
Wir haben eine Fahrerin, die sich bei früheren Arbeitgebern ständig Sprüche anhören musste. Ihr wurde nichts zugetraut, weil sie eine Frau ist. Bei uns wird sie behandelt wie alle anderen.
Gibt es in Ihrer Belegschaft keine Vorurteile?
Die erledigen sich, wenn Menschen erkennen, mit jemandem aus Syrien oder einer Person anderen Geschlechts kann ich gut zusammenarbeiten und Spaß haben.
Weniger Politik, mehr Menschlichkeit, das ist Ihre Strategie?
Das ist das Wichtigste. Liebe und Herzlichkeit sind es doch, wonach sich die Leute sehnen. Im rechten Gedankengut steckt so viel Hass. Die tragen viel mit sich herum, weil sie denken, sie müssen stark und männlich sein. Bei uns müssen sie das nicht. Wenn hier ein Mann reinkommt und völlig verzweifelt ist, weil es zu Hause nicht läuft, darf er heulen.
Was sagen Kunden über Ihren Aktivismus?
Zur Bundestagswahl habe ich einen Großkunden informiert, dass ich einen großen Spruch am Lkw anbringen werde: „Demokratie bekommst du nicht geliefert“. Er hat tief Luft geholt, aber es schließlich akzeptiert. Wir haben auch mal eine Frau in einer Villa in Dresden mit Möbel beliefert. Ich habe fünf Leute hingeschickt, zwei davon waren 27-jährige Syrer. „Schicken Sie mir nie mehr solche Leute. Ich habe gedacht, ich werde überfallen“, sagte sie.
Wie haben Sie da reagiert?
Ich habe diskutiert und gefragt, worüber sie sich Sorgen macht. Am Schluss habe ich ihr zugesichert, ihre Wünsche zu berücksichtigen. Das tat mir weh, aber ich bin nun mal Dienstleister.
Haben Sie schon mal Kunden wegen Ihres Engagements verloren?
Nicht, dass ich wüsste. Das wäre nicht schön, aber auch nicht tragisch. Ich will weiter in den Spiegel schauen können, nicht einknicken.

Bei der Kundin mit der Villa haben sie eingelenkt.
Ich versuche, einen Mittelweg zu finden.
Woher kommt ihr politisches Engagement?
Meine Mutter stammte aus einer anthroposophischen Familie. Ich wurde zu freiem Denken und Handeln erzogen. Über Politik haben wir am Küchentisch aber selten gesprochen. Ich habe Zimmermann gelernt, kam dann aber zu einer Theatergruppe, die überall in der Welt unterwegs war: Moskau, Pjöngjang, Paris, Amsterdam. Das war zu DDR-Zeiten etwas Besonderes und hat mir die Augen für die Welt geöffnet. Und mich spüren lassen, wie es ist, irgendwo fremd zu sein.
Im Herbst 2014 hat Pegida angefangen zu demonstrieren, seitdem setze ich mich für Demokratie ein. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl, als uns zu engagieren. Wenn wir keine Demokratie mehr haben, kommen keine Fachkräfte mehr aus dem Ausland. Jeder, der sich mit dem demografischen Wandel beschäftigt, weiß, wir brauchen sie.
Sie halten ihr Engagement für wirtschaftlich notwendig?
Dringend notwendig. Das Lustige ist: Über das Thema Fachkräfte kann man leise Politik machen. Wenn es um Einwanderung geht, sage ich: Jungs, ohne Zuwanderung wird hier keiner sein, der euch das Bier liefert oder euch im Pflegeheim hilft.
Glauben Sie, Sie können etwas bewirken?
Ja, ich merke bei manchen Mitarbeitern, dass sich was tut. Einer saß mal im Vorstellungsgespräch und hat etwas abschätzig gefragt: „Muss ich beim CSD mitfahren?“ „Nein, müssen Sie nicht“, habe ich geantwortet. „Sie müssen nur Stückgut von A nach B fahren und Möbel tragen.“ Wenn wir heute auf den CSD fahren, sitzt er am Steuer.






